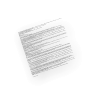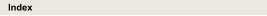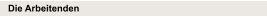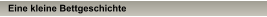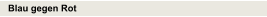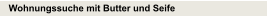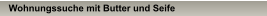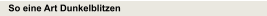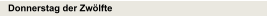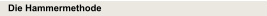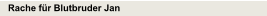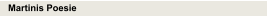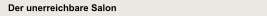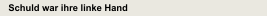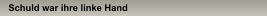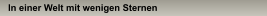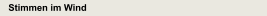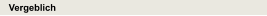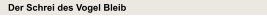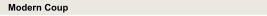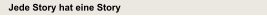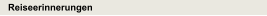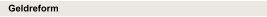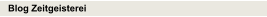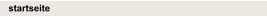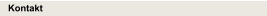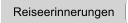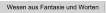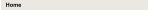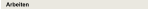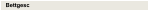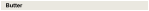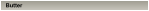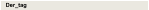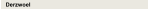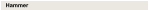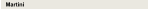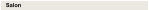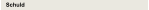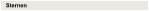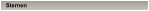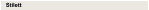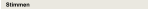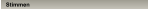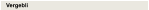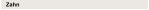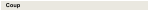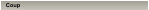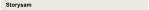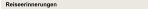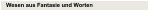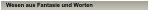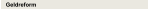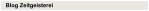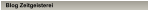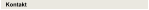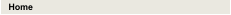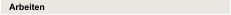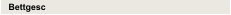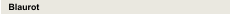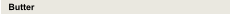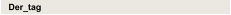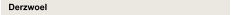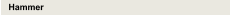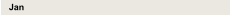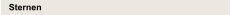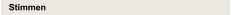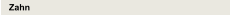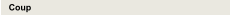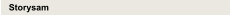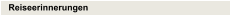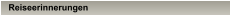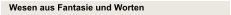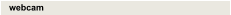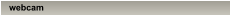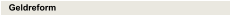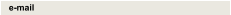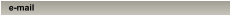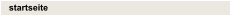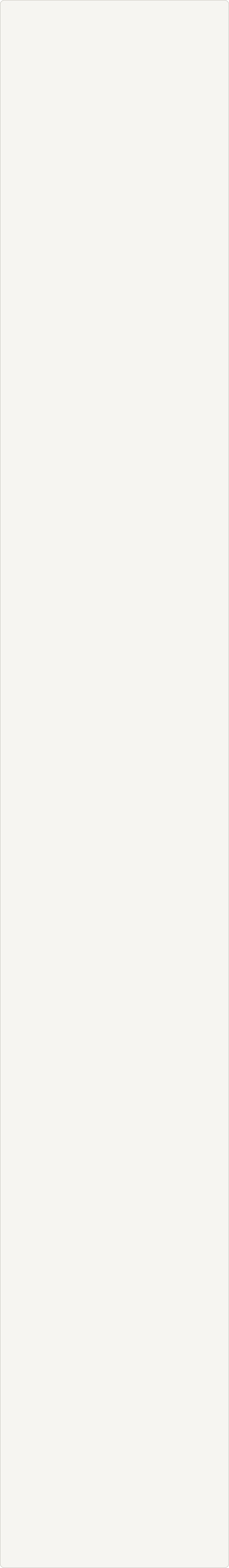
Die Arbeitenden
Wie immer im Sommer trafen wir uns noch bevor die Sonne ihre gleißende Glut verschüttete auch an
jenem Tag - der unser letzter Arbeitstag werden sollte - früh Morgens draußen vor dem Dorf, bei
der Werkstatt, die am Rande eines kleinen Flusses gelegenen war. Gähnend standen wir vor den
Stufen, welche hinauf zu der großen Tür mit dem gotischen Bogen führten. Die meisten von uns
reckten und streckten ihre Glieder vor Müdigkeit, so als wären wir erst in diesem Augenblick dem
Bett entstiegen.
Einer von denen, die am häufigsten gähnten meinte, dass es sinnvoller sei, zumindest aber
angenehmer, würden wir den Tag am Ufer des Flusses im Schatten der Weiden liegend verbringen
und nicht in der Werkstatt, schwitzend und an einem kalten wie leblosen Stück Metall feilend. Doch
ein paar andere foppten die, welche sich diesem Vorschlag anschlossen und als wir nun, infolge der
spaßigen Unterhaltung herzhaft lachend uns gegenseitig für den Tag aufmunterten, näherte sich mit
knatterndem Lärm das Moped mit unserem Ältesten, der, weil er der Älteste war, den Schlüssel für
die Werkstatt überantwortet bekommen hatte - so wie es die Tradition vorsah. Dass er immer
etwas später kam als alle anderen und uns ein paar Minuten vor verschlossener Tür warten ließ,
waren wir gewohnt. Und so verstummten die begonnen Unterhaltungen auch nicht mehr, wie es
früher üblich gewesen war, um das Ereignis des "auch schon" eintreffenden Schlüsselmannes - wie
wir ihn ob seiner Funktion nannten - gebührend zu huldigen.
Auf den Stufen zur Werkstatt bildete sich unmerklich ein Spalier aus dessen Reihen ein
vielstimmiges "morgen" murmelte, nachdem der Schlüsselmann sein Moped abgestellt hatte und zur
Tür hinauf stieg um sie zu öffnen.
Zuerst brachten wir unsere Taschen und Beutel mit dem Frühstücksbrot und unsere Henkelmänner
mit dem Mittagessen in eine kleine, von der eigentlichen Werkstatt abgeteilte Kammer. Dann
öffneten wir zu beiden Seiten des länglichen Gebäudes die Fenster und die sogleich einströmende
Morgenluft gab dem Raum, der nach Metall, nach Öl und Schlichtwasser roch, etwas beschwingtes,
vollkommen unbeschwertes, so das wir uns unter freiem Himmel wähnten. Obwohl uns noch ein langer
Arbeitstag bevorstand, empfanden wir diese ersten Minuten an jenen hellen Sommertagen als ein
uns ganz erfüllendes Erlebnisse und fast andächtig bewegten wir uns zwischen den Werkbänken,
genossen diese frischen unschuldigen Augenblicke des Tages, die taufeuchte Luft, die durch die
Fenster strömte und sich so lieblich mit dem vertrauten Geruch der Werkstatt vereinigte, bis dann
plötzlich irgend jemand etwas sagte, zum Beispiel, das er eigentlich überhaupt keine Lust habe zu
arbeiten. Dann rief ein andere, ja das kennen wir schon, wie üblich, und alle lachten.
So auch an jenem Tag. Bevor wir an unsere Arbeitsplätze gingen und das Werkzeug aus den
Schubläden holten, um es griffbereit und einer ewigen Ordnung hörig auf dem Tisch auszubreiten,
versammelten wir uns, noch spaßig schwatzend und gestikulierend um die tags zuvor angelieferte
dunkle, kunstvoll mit Eisen beschlagene Holzkiste, die an ihrem Platz in der Werkstatt unweit des
Einganges stand.
Als wir nun beisammen standen verstummte das Gelächter und in gespannter Neugier versetzt,
schauten wir den beiden zu, die begonnen hatten sich mit dem Deckel zu beschäftigen, der leicht
gewölbt war - ähnlich dem Deckel auf einer Schatulle oder einem Sarg. Einige sprachen leise, mehr
flüsternd, das es mit dieser Kiste etwas außergewöhnliches auf sich habe und die darin befindliche
Arbeit sicher von eigenwilliger Natur sei. Rohlinge, erklärte unser Schlüsselmann, würde ich in so
einer Kiste kaum aufbewahren,geschweige transportieren. Ein Familienschatz gehöre in so ein Möbel,
betonte er, so das wir alle lachten. Woher sollte er schon einen Familienschatz haben. Nur unser
Jüngster legte seinen Kopf nachdenklich zur Seite, schüttelte sich etwas, als fröre er, und erklärte,
dass er sich wie auf einem Friedhof fühle, bei einer Graböffnung. Allen starb das Schmunzeln und
wir schauten unseren Jüngsten verwundert an.
Die Kiste war ungewöhnlich fest verschlossen. Und so dauerte und dauerte es sie zu öffnen. Doch
endlich gelang es unseren beiden Kollegen den Deckel zu heben und bei allen zeichneten sich
deutliche Spuren der Erleichterung auf den Gesichtern ab - wenn auch ein wenig mit Enttäuschung.
Der Deckel ließ sich bar jeglichen Geräusches aufklappen und mit einem satten Ton stieß er gegen
die Seitenwand.
Unseren Blicken bot sich eine gleichmäßige Schicht Holzwolle; so wie es üblich war um metallische
Werkstücke für den Transport zu verpacken.
Wir schoben nach kurzem Zögern die Holzwolle beiseite und ergriffen einen Umschlag, der, wie wir
uns hastig überzeugten, Zeichnungen enthielt. Einer schnappte sich den Umschlag und lief zur
Stirnwand unserer Werkstatt, an der eine Tafel angebracht war, um daran Zeichnungen heften zu
können, während wir anderen in der Holzwolle wühlten und ganz vorsichtig einen Barren nach dem
anderen zutage beförderten, bis die Kiste leer war und jeder eines dieser unterarmlangen Rohlinge
in den Händen hielt.
Die Barren waren verrostet. Nichts ungewöhnliches, sicher, denn die meisten Rohlinge wurden uns
zumindest angerostet geliefert. Aber dieser Rost verwunderte uns wegen seiner roten, an manchen
Stellen sogar hellroten Farbe. Und dann diese Flecken: sanftporöse Rostflecken, kaum mehr als
daumnagelgroß und hautfarbend.
Wir drehten die Metallstücke hin und her, beschauten sie von allen Seiten, hielten die Barren in die
Höhe, drehten sie, um zu sehen ob sich die Farbe bei wechselndem Licht ändern würde; streichelten
zart über die Oberfläche und manch einer schabte - ganz vorsichtig - mit seinem Fingernagel über
den Rost. War das überhaupt Metall? Eisen sicher nicht. Auch Aluminium nicht, stellten einige
bestimmend fest, aber was sonst? Messing? Nein, Messing nicht und ebenso sicher war es auch kein
Kupfer. Jeder rätselte und versuchte sich zu erinnern ob ihm jemals ein solches Metall in die Hände
gekommen war: doch vergebens.
Die Zeichnung! rief plötzlich einer. Oh ja, die Zeichnung. Wir eilten zu unseren Werkbänken, legten
die Rohlinge neben den Schraubstöcken und versammelten uns umgehend bei der Tafel, wo wir mit
einem ratlosen Kopfschütteln desjenigen Empfangen wurden, der die Zeichnung an die Tafel
geheftet hatte und nun rätselnd davor stand.
Es waren sehr saubere Zeichnungen. Ansichten des zu fertigenden Werkstücks von allen Seiten mit
reichlich für uns Handwerker notwendigen Maßangaben versehen, nur: wir entdeckten weder einen
Hinweis über die Art des gelieferten Materials, noch gelang es uns die Zeichnung selbst zu deuten.
Auf abstruse Weise schienen unterschiedliche Torsie ineinander verschmolzen zu sein. Wenn wir
der Draufsicht rechtwinklige Kanten entnahmen, schienen diese Kanten bei den Seitenansichten
abgerundet zu sein. Überhaupt glaubten wir nach einiger Zeit des Rätseln eher ein kanten freies, ein
mit sanften Rundungen versehenes Werkstück anfertigen zu müssen, das uns mehr an ein abstraktes
Kunstwerk erinnerte denn an ein Maschinenteil, welches anzufertigen für uns ja eine alltägliche
Arbeit war.
Wie zusammengewachsene Kartoffeln witzelte schließlich einer und löste damit nicht nur Heiterkeit
aus. Einige machten ihrem angestauten Unmut Luft und riefen: Unverschämtheit! Wir sollten diese
Arbeit ablehnen. Doch andere meinten, dass es durchaus eine interessante Aufgabe sei und wir ihr
nicht gleich entsagen sollten, nur weil alles etwas ungewöhnlich sei. Ungewöhnlich! riefen die sich
empörenden, wobei sie höhnisch lachten, ja, wirklich ungewöhnlich, das kann man wohl meinen! Die
Mehrheit nickte aber den Fürsprechern zu und drängte sich näher an die Tafel heran.
Wir diskutierten und disputierten, wir überlegten und verwarfen, bis es tatsächlich einem von uns
gelang, mit für alle überzeugenden Argumenten eine Erklärung zu geben und das Werkstück zu
deuten.
Nachdem nunmehr schon viel Zeit verronnen war und die Sonne ihre merklich warmen Strahlen
durch die Fenster strömen ließ, begaben wir uns zu unseren Werkbänken und begannen unsere
Arbeit - so spät wie noch nie -, indem wir die Rohlinge in die Schraubstöcke spannten um ihnen
zunächst mit der flachen Grobpfeile die grundlegende Form zu geben.
Das Metall unter der eigenartigen, recht dichten, wenn auch leicht abzuraspelnden Rostschicht war
bleiern grau, nur viel härter als das butterweiche Blei, wenn auch ähnlich nachgiebig zäh. Es war ein
sonderbares Gefühl auf diesem Metall zu feilen. Anfangs stellten sich manche an, als sollten sie zum
ersten mal ein Werkstück bearbeiten. Es schien so, als hätten sie Angst dem Rohling eine Verletzung
beizufügen. Das wir trotz allem gut voran kamen und die verlorene Zeit bis zum Frühstück aufholten,
versöhnte uns ein wenig, wenn auch die Freude darüber nicht lange währte. Ein neuer Streit
entbrannte an den sich abzeichnenden Formen, denn Vorbehalte kamen auf ob der richtigen
Auslegung der Zeichnungen. Alsbald heftig diskutierend beendeten wir unsere Frühstückspause
ungewöhnlich früh um uns erneut vor der Tafel versammelt zu beraten. Und wirklich, die Argumente
waren berechtigt. Doch glücklicherweise kamen wir bald überein, wie die Arbeit fortzuführen sei -
noch war das Werkstück nicht verdorben. Wenn auch von nun an keine Einwände mehr erhoben
wurden, eine gewisse, nicht greifbare Skepsis begleitete auch weiterhin unser Werk.
Inzwischen stand die Sonne so hoch, das ihr Schein nur noch indirekt in unsere Werkstatt drang:
gespiegelt von dem im Licht flimmernden Weidenlaub, von dem hellen, saftigen Grün der den Weg
zur Werkstatt säumenden Wiesen, sowie von den weißgelb leuchtenden Staub auf dem Platz vor dem
Tor. Und manchmal blitzte die Sonne im Gestänge des Treppengeländers zu uns in die nun dunkler
erscheinende Werkstatt, wo wir vor unseren Schraubstöcken standen und schweigend arbeiteten.
Ja, ungewöhnlich genug: wir schwiegen und arbeiteten jeder für sich allein.
Endlich aber war Mittag und unsere Pause, der wir in der letzten halben Stunde erschöpft wie schon
lange nicht mehr entgegen fieberten, verbrachten wir am Ufer des kleinen Flusses, im Schatten der
Weiden.
Nachdem wir uns ein wenig in der kühlenden Nähe des Wassers erholt hatten, unsere Henkelmänner
geleert waren und wir nun dösend im Gras lagen, dabei den herumschwirrenden Insekten
gedankenverloren lauschten, meinte plötzlich der Jüngste, er habe den Eindruck das Metall, von dem
wir noch immer nicht wussten zu welcher Sorte der Metalle es gehöre, lebe.
Einige kicherten albern, so als wäre etwas süffisant-peinliches gesagt worden, andere schluckten
vernehmlich und riefen, als wollten sie einen Schrecken so schnell als möglich zurückdrängen, rede
kein dummes Zeug! Von dem barschen Ton überrascht, ließ sich der Junge in das Gras zurück sinken
und eine Weile war nur das Summen der Insekten zu hören, bis dann der Junge sich nochmals
aufrichtete und mit gedämpfter Stimme fragte - so als fürchte er nochmals zu erschrecken -, ob
wir denn auch die Männer gesehen hätten, gestern, als sie die Kiste brachten.
Ja sicher hatten wir sie gesehen. Allen waren die Männer aufgefallen, obwohl die Lieferung in
Verschwiegenheit vollzogen wurde. Jeder war von seiner Arbeit auf gemerkt um zu schauen und
nicht so, wie sonst, wenn ein Lieferwagen polternd vorgefahren kam und einige von uns
herausgerufen wurden um mit anzupacken, die schweren, teils klapperigen Kisten in die Werkstatt
zu hieven, dass dann einige - in ihrer Arbeit vertieft - nichts von alle dem mitbekamen und später
überrascht waren, entdeckten sie das neue Material.
Plötzlich war der in einem matten, licht verschlingenden Schwarz gehaltene Lieferwagen vor unsere
Werkstatt gestanden; zwei vornehm dunkel gekleidete Herrn mit marmorfarbenen Gesichtern
entstiegen ihrem Gefährt, öffneten lautlos die beiden Flügeltüren und zogen diese Kiste heraus, um
sie - bar jede Regung von Anstrengung - genau dort abzusetzen, wo wir wünschten geliefertes
Material deponiert zu bekommen, ohne das auch nur irgendeiner den uns fremden Männern eine
entsprechende Anweisung gegeben hatte. Und so lautlos, wie sie gekommen waren, verschwanden die
beiden auch wieder. Keinem war das entgangen. Und einige knöpften sich die Hemden zu als wäre ein
Eishauch durch die Werkstatt gestrichen.
Ja, so hatte es sich Tags zuvor ereignet, dachten - von der Frage des Jungen daran erinnert - wohl
alle. Und Junge, warum fragst du, sagte nach einer Weile der Schlüsselmann, worauf der Junge
antwortete, dass er das merkwürdig gefunden habe, schon gestern mit der Kiste und - und
heute...Ach was merkwürdig! wandte einer laut rufend ein, lasst uns jetzt wieder arbeiten, die Pause
ist um!
Stille trat ein. Nur die Bienen und Fliegen brummten durch das Gras, der dünne Wind raschelte mit
dem Laub der Weiden und aus der Ferne drang leises Geläut der Dorfkirche zu uns.Wir schauten auf
das alte, mit einem braunen Ziegeldach bedeckte Gebäude unserer Werkstatt, deren grober, wenn
auch leicht verwitterter Sandstein im grellen Sonnenlicht leuchtete.
Zögernd erhoben wir uns, dabei betont langsam unsere Kleidung von Grashalmen säubernd als warte
jeder auf irgend etwas, bis dann endlich der, der die Pause für beendet erklärt hatte, ausrief, ach
was, so ein albernes Zeug! und demonstrativ heftigen Schrittes auf die Werkstatt zuging, die
Stufen hoch eilte und zielstrebig in das Gebäude verschwand.
Wir aber standen auf der Wiese, regten uns nicht und schauten nur hinüber zu dem großen Eingang,
der sich im grellen Sonnenlicht wie ein alles verschlingender Rachen dem Tag entgegen sperrte.
Wir müssten ihm folgen, dachten wohl alle. Doch zögerten wir, bis endlich der Jüngste und der
Schlüsselmann, ja bis wir alle uns zaudernd in Bewegung setzten und so folgten wir unserem
Kollegen, langsam wie vorsichtig, so als müssten wir jeden Augenblick auf dem Absatz kehrt machen.
Es drängte sich keiner durch die Tür zu gehen. Als wir aber den Vor preschenden eifrig an seinem
Werkstück arbeiten sahen und dazu erleichtert feststellten, dass alles sich noch in gewohnter
Ordnung befand, begaben wir uns zu unseren Plätzen, ergriffen rasch die Feile um so schnell als
möglich die uns nun albern anmutenden Gefühle der vergangenen Minuten vergessen zu machen.
Wir arbeiteten so schweigsam wie schon den ganzen Vormittag. Nur die schrubbenden und
schabenden Geräusche unserer Feilen mischten sich mit den lebhaften Klängen einer sommerlichen
Natur. Laute, in die hinein irgendwann der Schlüsselmann rief, was ist eigentlich geschehen! jedoch
sogleich mit seiner Arbeit weitermachte, als wäre das gar keine Frage sondern nur ein laut
gesprochener, verstreuter Gedanke gewesen. Doch der Schein der angespannten Arbeit trog. Wir
beobachteten uns ganz offen, indem wir immer und immer wieder mit der Arbeit inne hielten,
unseren Blick durch die Werkstatt streifen ließen, nach irgend etwas suchend, bis unsere Augen sich
bei irgendeinem verfingen und sehen konnten, wie dieser Kollege nicht nur das Werkstück zart in
den Händen hielt und versonnen betrachtete; wir beobachteten uns auch dabei, wie wir die
Feinspäne vorsichtig zwischen die Finger nahmen und die so mit den Spänen benetzten Kuppen
prüfend gegeneinander rieben, bis wir Augen auf uns gerichtet spürten und uns mit einem
verschämten Lächeln eilends wieder in die Arbeit vertieften.
Als dann die ersten Sonnenstrahlen zwischen dem Laub der flussabwärts stehenden Weiden durch
die Fenster blinzelten - auf der anderen Seite der Werkstatt, der Abendseite, wie wir sie auch
nannten - und den Raum in eine späte Helligkeit tauchten, durchbrach einer unsere mönchische
Stille, indem er rief: es sei nun die Zeit mit der Präzisionsfile weiter zu arbeiten. Wir schauten auf,
befühlten unser Werkstück, nickten zustimmend und setzten unsere Arbeit mit dem neuen
Werkzeug fort.
Der Umgang mit dieser Feile verlangt ein zartes Fingerspitzengefühl. Wenn es auch kaum zu glauben
ist, bei diesem sanft anmutenden Werkzeug, aber: eins, zwei drei und schon ist zu viel ab, dann ist
das Werkstück verdorben, eine Menge Arbeitszeit vertan, das Material zumeist auch für andere
Aufträge unbrauchbar: also nichts als Kosten und Ärger. Doch nicht allein diese äußeren, mehr
ökonomischen Gründe mahnen zur Genauigkeit: es war für uns alle ein vom Herzen quellendes
Bedürfnis unseren Arbeiten die größtmögliche Genauigkeit angedeihen zu lassen, der Innung zur
Ehre gereichen, dem Handwerk mit Stolz in die eigenen Fähigkeiten ergeben zu sein, kurz: an den
letzten, das Werkstück vollendenden Tätigkeiten erkennt man einen Meister seines Faches! Innigste
Verbundenheit mit dem Material ist geboten, jeder Strich über das Werkstück will gut angesetzt
und durchgeführt sein, einer mehr wäre vielleicht schon zu viel. Und da sage einer, Metalle zu
bearbeiten sei fade, es sei ja bloß leblose, kalte Materie. Nein! gestreichelt werden will es, denn nur
dann vermag es seine für uns so nützlichen Eigenschaften zu entfalten. Schichtwassergebrauch
macht die ehedem schon sanft zu nennende Präzisionspfeile noch glatter, so das sich das Stahl der
Feile mit dem Werkstück reibt, wie zwei Körper eines sich liebenden Paares aneinander schmiegen,
keinen Raum lassend für die Rohheit des Lebens.
Inzwischen strömte abendliche Frische durch die Fenster und die Sonne verzauberte mit ihrem
rötlichem Licht den Fluss, die Weiden und Wiesen. Wir lächelten uns zu, etwas mit Stolz, darum
wissend die Arbeit bald getan zu haben und eine lockere, beschwingte, der Sorge um diese
eigenartige, nun bald gelöste Aufgabe entledigte Stimmung machte sich unter uns breit; einige
sangen leise vor sich hin oder pfiffen, andere besprachen wie sie den Feierabend verbringen wollten.
Die am Tag unterbliebene Kollegialität stellte sich nun um so heftiger ein; wir redeten laut über
dieses und jenes, versprachen uns gegenseitig bei Ausbesserungen an unseren Häusern zu helfen, wir
erkundigten uns nach dem Befinden von Frau, Kinder und Verwandte; wir verabredeten einen
Skatabend und alles dieses sprudelte aus uns heraus, in so kurzer Zeit und so heftig, das sich eine
so ausgelassene Stimmung einstellte wie selten zuvor.
Und endlich lag es vor uns, dieses sonderbare Gebilde, welches anzufertigen wir beauftragt waren.
Wir hatten es eingeölt um die Rostbildung zu verhindern; nun lag es da, auf dem dicken, öligen Tuch
neben dem Schraubstock. Kaum einer aber mochte das Werkstück noch länger betrachten und so
legten wir rasch unser Werkzeug in die Schubläden. Wir fegten die Werkstatt aus, wir lauschten
für einen Moment dem abendlichen Gesang der Vögel, wir wuschen unsere Hände und Arme unter
dem kühlenden Wasser eines Krans. Und ehe wir uns versahen standen wir auf den Stufen vor der
Tür, dem Schlüsselmann zuschauend, wie er mit besonderer Sorgfalt die Werkstatt verschloss um
sich darauf wortlos auf sein Moped zu setzen und mit einem letzten grüßenden Blick von uns zu
fahren.
Unterdessen war die Nacht angebrochen und der Mond war über dem Wald aufgegangen. Wieder
schweigsam geworden gaben wir uns die Hand und verabschiedeten uns voneinander. Schon ein gutes
Stück des Weges gelaufen schauten sich der eine oder andere noch einmal um. Die Werkstatt lag im
silbernen Licht des Mondes wie eine dunkle Trutzburg aus längst verflossener Zeit, in deren
Gemäuer Geister der Unwirklichkeit wachten und ewig auf eine ferne Zukunft hofften. Wir aber
gingen und kehrten nie wieder an unsere Werkbänke zurück.
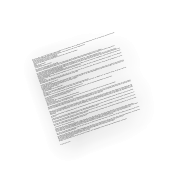

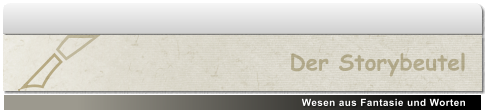
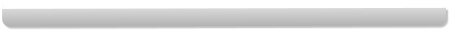
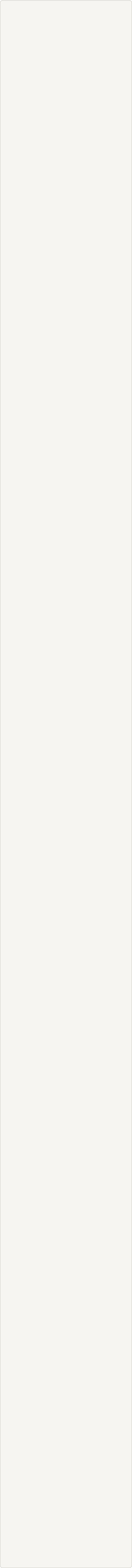
Die Arbeitenden
Wie immer im Sommer trafen wir uns noch bevor
die Sonne ihre gleißende Glut verschüttete auch an
jenem Tag - der unser letzter Arbeitstag werden
sollte - früh Morgens draußen vor dem Dorf, bei
der Werkstatt, die am Rande eines kleinen Flusses
gelegenen war. Gähnend standen wir vor den
Stufen, welche hinauf zu der großen Tür mit dem
gotischen Bogen führten. Die meisten von uns
reckten und streckten ihre Glieder vor Müdigkeit,
so als wären wir erst in diesem Augenblick dem
Bett entstiegen.
Einer von denen, die am häufigsten gähnten meinte,
dass es sinnvoller sei, zumindest aber angenehmer,
würden wir den Tag am Ufer des Flusses im
Schatten der Weiden liegend verbringen und nicht in der Werkstatt,
schwitzend und an einem kalten wie leblosen Stück Metall feilend. Doch
ein paar andere foppten die, welche sich diesem Vorschlag anschlossen
und als wir nun, infolge der spaßigen Unterhaltung herzhaft lachend uns
gegenseitig für den Tag aufmunterten, näherte sich mit knatterndem
Lärm das Moped mit unserem Ältesten, der, weil er der Älteste war, den
Schlüssel für die Werkstatt überantwortet bekommen hatte - so wie es
die Tradition vorsah. Dass er immer etwas später kam als alle anderen und
uns ein paar Minuten vor verschlossener Tür warten ließ, waren wir
gewohnt. Und so verstummten die begonnen Unterhaltungen auch nicht
mehr, wie es früher üblich gewesen war, um das Ereignis des "auch schon"
eintreffenden Schlüsselmannes - wie wir ihn ob seiner Funktion nannten -
gebührend zu huldigen.
Auf den Stufen zur Werkstatt bildete sich unmerklich ein Spalier aus
dessen Reihen ein vielstimmiges "morgen" murmelte, nachdem der
Schlüsselmann sein Moped abgestellt hatte und zur Tür hinauf stieg um
sie zu öffnen.
Zuerst brachten wir unsere Taschen und Beutel mit dem Frühstücksbrot
und unsere Henkelmänner mit dem Mittagessen in eine kleine, von der
eigentlichen Werkstatt abgeteilte Kammer. Dann öffneten wir zu beiden
Seiten des länglichen Gebäudes die Fenster und die sogleich einströmende
Morgenluft gab dem Raum, der nach Metall, nach Öl und Schlichtwasser
roch, etwas beschwingtes, vollkommen unbeschwertes, so das wir uns
unter freiem Himmel wähnten. Obwohl uns noch ein langer Arbeitstag
bevorstand, empfanden wir diese ersten Minuten an jenen hellen
Sommertagen als ein uns ganz erfüllendes Erlebnisse und fast andächtig
bewegten wir uns zwischen den Werkbänken, genossen diese frischen
unschuldigen Augenblicke des Tages, die taufeuchte Luft, die durch die
Fenster strömte und sich so lieblich mit dem vertrauten Geruch der
Werkstatt vereinigte, bis dann plötzlich irgend jemand etwas sagte, zum
Beispiel, das er eigentlich überhaupt keine Lust habe zu arbeiten. Dann
rief ein andere, ja das kennen wir schon, wie üblich, und alle lachten.
So auch an jenem Tag. Bevor wir an unsere Arbeitsplätze gingen und das
Werkzeug aus den Schubläden holten, um es griffbereit und einer ewigen
Ordnung hörig auf dem Tisch auszubreiten, versammelten wir uns, noch
spaßig schwatzend und gestikulierend um die tags zuvor angelieferte
dunkle, kunstvoll mit Eisen beschlagene Holzkiste, die an ihrem Platz in
der Werkstatt unweit des Einganges stand.
Als wir nun beisammen standen verstummte das Gelächter und in
gespannter Neugier versetzt, schauten wir den beiden zu, die begonnen
hatten sich mit dem Deckel zu beschäftigen, der leicht gewölbt war -
ähnlich dem Deckel auf einer Schatulle oder einem Sarg. Einige sprachen
leise, mehr flüsternd, das es mit dieser Kiste etwas außergewöhnliches auf
sich habe und die darin befindliche Arbeit sicher von eigenwilliger Natur
sei. Rohlinge, erklärte unser Schlüsselmann, würde ich in so einer Kiste
kaum aufbewahren,geschweige transportieren. Ein Familienschatz gehöre
in so ein Möbel, betonte er, so das wir alle lachten. Woher sollte er schon
einen Familienschatz haben. Nur unser Jüngster legte seinen Kopf
nachdenklich zur Seite, schüttelte sich etwas, als fröre er, und erklärte,
dass er sich wie auf einem Friedhof fühle, bei einer Graböffnung. Allen
starb das Schmunzeln und wir schauten unseren Jüngsten verwundert an.
Die Kiste war ungewöhnlich fest verschlossen. Und so dauerte und dauerte
es sie zu öffnen. Doch endlich gelang es unseren beiden Kollegen den
Deckel zu heben und bei allen zeichneten sich deutliche Spuren der
Erleichterung auf den Gesichtern ab - wenn auch ein wenig mit
Enttäuschung. Der Deckel ließ sich bar jeglichen Geräusches aufklappen
und mit einem satten Ton stieß er gegen die Seitenwand.
Unseren Blicken bot sich eine gleichmäßige Schicht Holzwolle; so wie es
üblich war um metallische Werkstücke für den Transport zu verpacken.
Wir schoben nach kurzem Zögern die Holzwolle beiseite und ergriffen
einen Umschlag, der, wie wir uns hastig überzeugten, Zeichnungen
enthielt. Einer schnappte sich den Umschlag und lief zur Stirnwand
unserer Werkstatt, an der eine Tafel angebracht war, um daran
Zeichnungen heften zu können, während wir anderen in der Holzwolle
wühlten und ganz vorsichtig einen Barren nach dem anderen zutage
beförderten, bis die Kiste leer war und jeder eines dieser unterarmlangen
Rohlinge in den Händen hielt.
Die Barren waren verrostet. Nichts ungewöhnliches, sicher, denn die
meisten Rohlinge wurden uns zumindest angerostet geliefert. Aber dieser
Rost verwunderte uns wegen seiner roten, an manchen Stellen sogar
hellroten Farbe. Und dann diese Flecken: sanftporöse Rostflecken, kaum
mehr als daumnagelgroß und hautfarbend.
Wir drehten die Metallstücke hin und her, beschauten sie von allen
Seiten, hielten die Barren in die Höhe, drehten sie, um zu sehen ob sich
die Farbe bei wechselndem Licht ändern würde; streichelten zart über die
Oberfläche und manch einer schabte - ganz vorsichtig - mit seinem
Fingernagel über den Rost. War das überhaupt Metall? Eisen sicher nicht.
Auch Aluminium nicht, stellten einige bestimmend fest, aber was sonst?
Messing? Nein, Messing nicht und ebenso sicher war es auch kein Kupfer.
Jeder rätselte und versuchte sich zu erinnern ob ihm jemals ein solches
Metall in die Hände gekommen war: doch vergebens.
Die Zeichnung! rief plötzlich einer. Oh ja, die Zeichnung. Wir eilten zu
unseren Werkbänken, legten die Rohlinge neben den Schraubstöcken und
versammelten uns umgehend bei der Tafel, wo wir mit einem ratlosen
Kopfschütteln desjenigen Empfangen wurden, der die Zeichnung an die
Tafel geheftet hatte und nun rätselnd davor stand.
Es waren sehr saubere Zeichnungen. Ansichten des zu fertigenden
Werkstücks von allen Seiten mit reichlich für uns Handwerker
notwendigen Maßangaben versehen, nur: wir entdeckten weder einen
Hinweis über die Art des gelieferten Materials, noch gelang es uns die
Zeichnung selbst zu deuten. Auf abstruse Weise schienen
unterschiedliche Torsie ineinander verschmolzen zu sein. Wenn wir der
Draufsicht rechtwinklige Kanten entnahmen, schienen diese Kanten bei
den Seitenansichten abgerundet zu sein. Überhaupt glaubten wir nach
einiger Zeit des Rätseln eher ein kanten freies, ein mit sanften Rundungen
versehenes Werkstück anfertigen zu müssen, das uns mehr an ein
abstraktes Kunstwerk erinnerte denn an ein Maschinenteil, welches
anzufertigen für uns ja eine alltägliche Arbeit war.
Wie zusammengewachsene Kartoffeln witzelte schließlich einer und löste
damit nicht nur Heiterkeit aus. Einige machten ihrem angestauten Unmut
Luft und riefen: Unverschämtheit! Wir sollten diese Arbeit ablehnen.
Doch andere meinten, dass es durchaus eine interessante Aufgabe sei und
wir ihr nicht gleich entsagen sollten, nur weil alles etwas ungewöhnlich sei.
Ungewöhnlich! riefen die sich empörenden, wobei sie höhnisch lachten, ja,
wirklich ungewöhnlich, das kann man wohl meinen! Die Mehrheit nickte
aber den Fürsprechern zu und drängte sich näher an die Tafel heran.
Wir diskutierten und disputierten, wir überlegten und verwarfen, bis es
tatsächlich einem von uns gelang, mit für alle überzeugenden Argumenten
eine Erklärung zu geben und das Werkstück zu deuten.
Nachdem nunmehr schon viel Zeit verronnen war und die Sonne ihre
merklich warmen Strahlen durch die Fenster strömen ließ, begaben wir
uns zu unseren Werkbänken und begannen unsere Arbeit - so spät wie
noch nie -, indem wir die Rohlinge in die Schraubstöcke spannten um ihnen
zunächst mit der flachen Grobpfeile die grundlegende Form zu geben.
Das Metall unter der eigenartigen, recht dichten, wenn auch leicht
abzuraspelnden Rostschicht war bleiern grau, nur viel härter als das
butterweiche Blei, wenn auch ähnlich nachgiebig zäh. Es war ein
sonderbares Gefühl auf diesem Metall zu feilen. Anfangs stellten sich
manche an, als sollten sie zum ersten mal ein Werkstück bearbeiten. Es
schien so, als hätten sie Angst dem Rohling eine Verletzung beizufügen.
Das wir trotz allem gut voran kamen und die verlorene Zeit bis zum
Frühstück aufholten, versöhnte uns ein wenig, wenn auch die Freude
darüber nicht lange währte. Ein neuer Streit entbrannte an den sich
abzeichnenden Formen, denn Vorbehalte kamen auf ob der richtigen
Auslegung der Zeichnungen. Alsbald heftig diskutierend beendeten wir
unsere Frühstückspause ungewöhnlich früh um uns erneut vor der Tafel
versammelt zu beraten. Und wirklich, die Argumente waren berechtigt.
Doch glücklicherweise kamen wir bald überein, wie die Arbeit
fortzuführen sei - noch war das Werkstück nicht verdorben. Wenn auch
von nun an keine Einwände mehr erhoben wurden, eine gewisse, nicht
greifbare Skepsis begleitete auch weiterhin unser Werk.
Inzwischen stand die Sonne so hoch, das ihr Schein nur noch indirekt in
unsere Werkstatt drang: gespiegelt von dem im Licht flimmernden
Weidenlaub, von dem hellen, saftigen Grün der den Weg zur Werkstatt
säumenden Wiesen, sowie von den weißgelb leuchtenden Staub auf dem
Platz vor dem Tor. Und manchmal blitzte die Sonne im Gestänge des
Treppengeländers zu uns in die nun dunkler erscheinende Werkstatt, wo
wir vor unseren Schraubstöcken standen und schweigend arbeiteten. Ja,
ungewöhnlich genug: wir schwiegen und arbeiteten jeder für sich allein.
Endlich aber war Mittag und unsere Pause, der wir in der letzten halben
Stunde erschöpft wie schon lange nicht mehr entgegen fieberten,
verbrachten wir am Ufer des kleinen Flusses, im Schatten der Weiden.
Nachdem wir uns ein wenig in der kühlenden Nähe des Wassers erholt
hatten, unsere Henkelmänner geleert waren und wir nun dösend im Gras
lagen, dabei den herumschwirrenden Insekten gedankenverloren
lauschten, meinte plötzlich der Jüngste, er habe den Eindruck das Metall,
von dem wir noch immer nicht wussten zu welcher Sorte der Metalle es
gehöre, lebe.
Einige kicherten albern, so als wäre etwas süffisant-peinliches gesagt
worden, andere schluckten vernehmlich und riefen, als wollten sie einen
Schrecken so schnell als möglich zurückdrängen, rede kein dummes Zeug!
Von dem barschen Ton überrascht, ließ sich der Junge in das Gras zurück
sinken und eine Weile war nur das Summen der Insekten zu hören, bis
dann der Junge sich nochmals aufrichtete und mit gedämpfter Stimme
fragte - so als fürchte er nochmals zu erschrecken -, ob wir denn auch die
Männer gesehen hätten, gestern, als sie die Kiste brachten.
Ja sicher hatten wir sie gesehen. Allen waren die Männer aufgefallen,
obwohl die Lieferung in Verschwiegenheit vollzogen wurde. Jeder war von
seiner Arbeit auf gemerkt um zu schauen und nicht so, wie sonst, wenn ein
Lieferwagen polternd vorgefahren kam und einige von uns herausgerufen
wurden um mit anzupacken, die schweren, teils klapperigen Kisten in die
Werkstatt zu hieven, dass dann einige - in ihrer Arbeit vertieft - nichts
von alle dem mitbekamen und später überrascht waren, entdeckten sie das
neue Material.
Plötzlich war der in einem matten, licht verschlingenden Schwarz
gehaltene Lieferwagen vor unsere Werkstatt gestanden; zwei vornehm
dunkel gekleidete Herrn mit marmorfarbenen Gesichtern entstiegen
ihrem Gefährt, öffneten lautlos die beiden Flügeltüren und zogen diese
Kiste heraus, um sie - bar jede Regung von Anstrengung - genau dort
abzusetzen, wo wir wünschten geliefertes Material deponiert zu
bekommen, ohne das auch nur irgendeiner den uns fremden Männern eine
entsprechende Anweisung gegeben hatte. Und so lautlos, wie sie
gekommen waren, verschwanden die beiden auch wieder. Keinem war das
entgangen. Und einige knöpften sich die Hemden zu als wäre ein Eishauch
durch die Werkstatt gestrichen.
Ja, so hatte es sich Tags zuvor ereignet, dachten - von der Frage des
Jungen daran erinnert - wohl alle. Und Junge, warum fragst du, sagte nach
einer Weile der Schlüsselmann, worauf der Junge antwortete, dass er das
merkwürdig gefunden habe, schon gestern mit der Kiste und - und
heute...Ach was merkwürdig! wandte einer laut rufend ein, lasst uns jetzt
wieder arbeiten, die Pause ist um!
Stille trat ein. Nur die Bienen und Fliegen brummten durch das Gras, der
dünne Wind raschelte mit dem Laub der Weiden und aus der Ferne drang
leises Geläut der Dorfkirche zu uns.Wir schauten auf das alte, mit einem
braunen Ziegeldach bedeckte Gebäude unserer Werkstatt, deren grober,
wenn auch leicht verwitterter Sandstein im grellen Sonnenlicht leuchtete.
Zögernd erhoben wir uns, dabei betont langsam unsere Kleidung von
Grashalmen säubernd als warte jeder auf irgend etwas, bis dann endlich
der, der die Pause für beendet erklärt hatte, ausrief, ach was, so ein
albernes Zeug! und demonstrativ heftigen Schrittes auf die Werkstatt
zuging, die Stufen hoch eilte und zielstrebig in das Gebäude verschwand.
Wir aber standen auf der Wiese, regten uns nicht und schauten nur
hinüber zu dem großen Eingang, der sich im grellen Sonnenlicht wie ein
alles verschlingender Rachen dem Tag entgegen sperrte.
Wir müssten ihm folgen, dachten wohl alle. Doch zögerten wir, bis endlich
der Jüngste und der Schlüsselmann, ja bis wir alle uns zaudernd in
Bewegung setzten und so folgten wir unserem Kollegen, langsam wie
vorsichtig, so als müssten wir jeden Augenblick auf dem Absatz kehrt
machen. Es drängte sich keiner durch die Tür zu gehen. Als wir aber den
Vor preschenden eifrig an seinem Werkstück arbeiten sahen und dazu
erleichtert feststellten, dass alles sich noch in gewohnter Ordnung
befand, begaben wir uns zu unseren Plätzen, ergriffen rasch die Feile um
so schnell als möglich die uns nun albern anmutenden Gefühle der
vergangenen Minuten vergessen zu machen.
Wir arbeiteten so schweigsam wie schon den ganzen Vormittag. Nur die
schrubbenden und schabenden Geräusche unserer Feilen mischten sich mit
den lebhaften Klängen einer sommerlichen Natur. Laute, in die hinein
irgendwann der Schlüsselmann rief, was ist eigentlich geschehen! jedoch
sogleich mit seiner Arbeit weitermachte, als wäre das gar keine Frage
sondern nur ein laut gesprochener, verstreuter Gedanke gewesen. Doch
der Schein der angespannten Arbeit trog. Wir beobachteten uns ganz
offen, indem wir immer und immer wieder mit der Arbeit inne hielten,
unseren Blick durch die Werkstatt streifen ließen, nach irgend etwas
suchend, bis unsere Augen sich bei irgendeinem verfingen und sehen
konnten, wie dieser Kollege nicht nur das Werkstück zart in den Händen
hielt und versonnen betrachtete; wir beobachteten uns auch dabei, wie wir
die Feinspäne vorsichtig zwischen die Finger nahmen und die so mit den
Spänen benetzten Kuppen prüfend gegeneinander rieben, bis wir Augen
auf uns gerichtet spürten und uns mit einem verschämten Lächeln eilends
wieder in die Arbeit vertieften.
Als dann die ersten Sonnenstrahlen zwischen dem Laub der flussabwärts
stehenden Weiden durch die Fenster blinzelten - auf der anderen Seite
der Werkstatt, der Abendseite, wie wir sie auch nannten - und den Raum
in eine späte Helligkeit tauchten, durchbrach einer unsere mönchische
Stille, indem er rief: es sei nun die Zeit mit der Präzisionsfile weiter zu
arbeiten. Wir schauten auf, befühlten unser Werkstück, nickten
zustimmend und setzten unsere Arbeit mit dem neuen Werkzeug fort.
Der Umgang mit dieser Feile verlangt ein zartes Fingerspitzengefühl.
Wenn es auch kaum zu glauben ist, bei diesem sanft anmutenden
Werkzeug, aber: eins, zwei drei und schon ist zu viel ab, dann ist das
Werkstück verdorben, eine Menge Arbeitszeit vertan, das Material
zumeist auch für andere Aufträge unbrauchbar: also nichts als Kosten und
Ärger. Doch nicht allein diese äußeren, mehr ökonomischen Gründe mahnen
zur Genauigkeit: es war für uns alle ein vom Herzen quellendes Bedürfnis
unseren Arbeiten die größtmögliche Genauigkeit angedeihen zu lassen, der
Innung zur Ehre gereichen, dem Handwerk mit Stolz in die eigenen
Fähigkeiten ergeben zu sein, kurz: an den letzten, das Werkstück
vollendenden Tätigkeiten erkennt man einen Meister seines Faches!
Innigste Verbundenheit mit dem Material ist geboten, jeder Strich über
das Werkstück will gut angesetzt und durchgeführt sein, einer mehr wäre
vielleicht schon zu viel. Und da sage einer, Metalle zu bearbeiten sei fade,
es sei ja bloß leblose, kalte Materie. Nein! gestreichelt werden will es,
denn nur dann vermag es seine für uns so nützlichen Eigenschaften zu
entfalten. Schichtwassergebrauch macht die ehedem schon sanft zu
nennende Präzisionspfeile noch glatter, so das sich das Stahl der Feile mit
dem Werkstück reibt, wie zwei Körper eines sich liebenden Paares
aneinander schmiegen, keinen Raum lassend für die Rohheit des Lebens.
Inzwischen strömte abendliche Frische durch die Fenster und die Sonne
verzauberte mit ihrem rötlichem Licht den Fluss, die Weiden und Wiesen.
Wir lächelten uns zu, etwas mit Stolz, darum wissend die Arbeit bald
getan zu haben und eine lockere, beschwingte, der Sorge um diese
eigenartige, nun bald gelöste Aufgabe entledigte Stimmung machte sich
unter uns breit; einige sangen leise vor sich hin oder pfiffen, andere
besprachen wie sie den Feierabend verbringen wollten. Die am Tag
unterbliebene Kollegialität stellte sich nun um so heftiger ein; wir redeten
laut über dieses und jenes, versprachen uns gegenseitig bei
Ausbesserungen an unseren Häusern zu helfen, wir erkundigten uns nach
dem Befinden von Frau, Kinder und Verwandte; wir verabredeten einen
Skatabend und alles dieses sprudelte aus uns heraus, in so kurzer Zeit und
so heftig, das sich eine so ausgelassene Stimmung einstellte wie selten
zuvor.
Und endlich lag es vor uns, dieses sonderbare Gebilde, welches
anzufertigen wir beauftragt waren. Wir hatten es eingeölt um die
Rostbildung zu verhindern; nun lag es da, auf dem dicken, öligen Tuch
neben dem Schraubstock. Kaum einer aber mochte das Werkstück noch
länger betrachten und so legten wir rasch unser Werkzeug in die
Schubläden. Wir fegten die Werkstatt aus, wir lauschten für einen
Moment dem abendlichen Gesang der Vögel, wir wuschen unsere Hände
und Arme unter dem kühlenden Wasser eines Krans. Und ehe wir uns
versahen standen wir auf den Stufen vor der Tür, dem Schlüsselmann
zuschauend, wie er mit besonderer Sorgfalt die Werkstatt verschloss um
sich darauf wortlos auf sein Moped
zu setzen und mit einem letzten
grüßenden Blick von uns zu fahren.
Unterdessen war die Nacht
angebrochen und der Mond war über
dem Wald aufgegangen. Wieder
schweigsam geworden gaben wir uns
die Hand und verabschiedeten uns
voneinander. Schon ein gutes Stück
des Weges gelaufen schauten sich
der eine oder andere noch einmal
um. Die Werkstatt lag im silbernen
Licht des Mondes wie eine dunkle
Trutzburg aus längst verflossener
Zeit, in deren Gemäuer Geister der
Unwirklichkeit wachten und ewig auf
eine ferne Zukunft hofften. Wir
aber gingen und kehrten nie wieder
an unsere Werkbänke zurück.