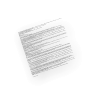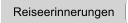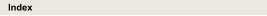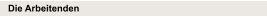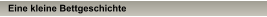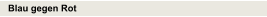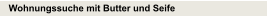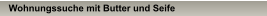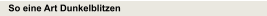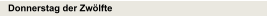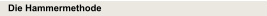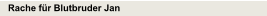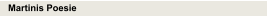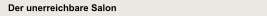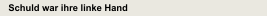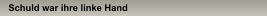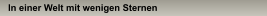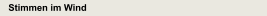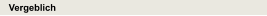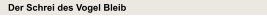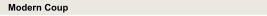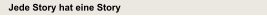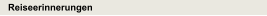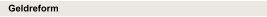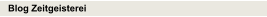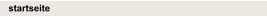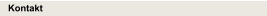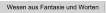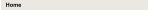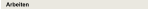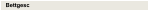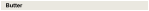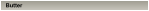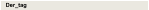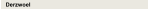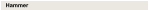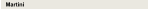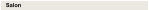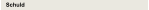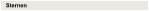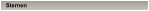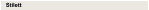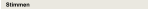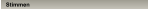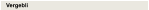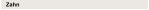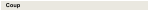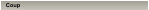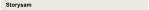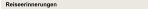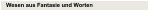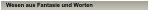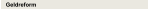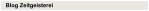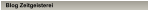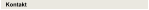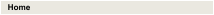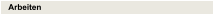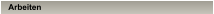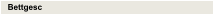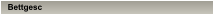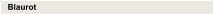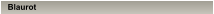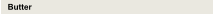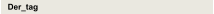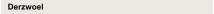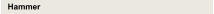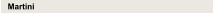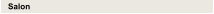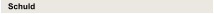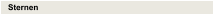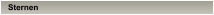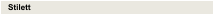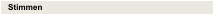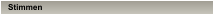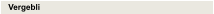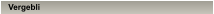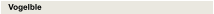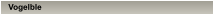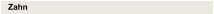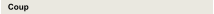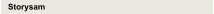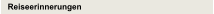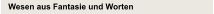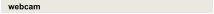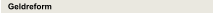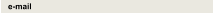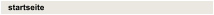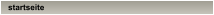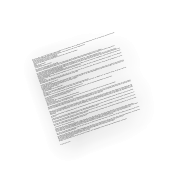


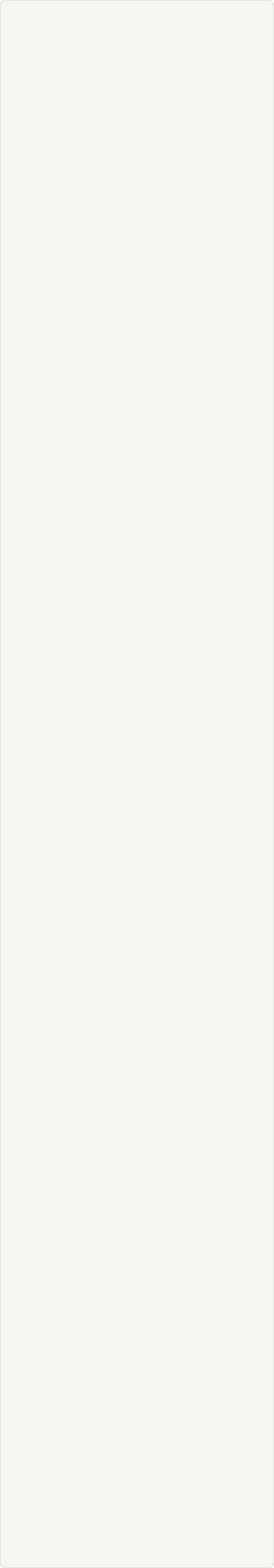
Die Hammermethode
Nun haben sie mir den Hammer weggenommen. Alles hätten sie mir wegnehmen können, nur nicht
meinen geliebten Hammer.
Stundenlang sitze ich da und starre auf die Wand. Die Wand ist weiß. Und dann lege ich mich auf
meine Pritsche und schaue durch das Fenster in den Himmel. Gestern abend war er dunkelblau.
Ein kleines Flugzeug zog brummend langsam von der rechten oberen zur linken unteren Ecke. Am
Heck blinkte ein weißes Licht. Das war schön. Ganz unvermutet war das Flugzeug in dem
Fensterquadrat aufgetaucht. Und nur wenige Sekunden brauchte es um das Fenster zu
durchqueren. Eine Träne löste sich aus meinem Auge und lief heiß die Wange hinab, dicht am
äußersten Mundwinkel vorbei zum Kinn. Ich war glücklich.
Meine linke Hand ist vernarbt und verknorpelt. Natürlich, wie sollte sie auch anders? Sie ist auch
größer als die rechte Hand. Nicht unbedingt dicker, eher breiter, großflächiger. Ein verknorpelter
Toilettendeckel als Hand, hatte mir ein Kollege gesagt. Er konnte es nicht verstehen und war mit
seinem Unverständnis nicht allein. Denn niemand versteht mich.
Mein Kollege fährt jedes Wochenende mit seinem Wohnmobil an einen kleinen See und angelt. Er
und seine Freunde angeln soviel, dass sie ihren Fang eigentlich nicht selbst essen können. So hat
er mir auch einmal ein paar schöne Fische mitgegeben. Einige Tage später fragte er mich, wie sie
geschmeckt hätten. Seine Augen glänzten, als er mich dies fragte. Mir aber waren die Fische nicht
bekommen. Sie schienen mir etwas faulig zu schmecken, wie Morast. Deshalb brauchte er mir
auch keine neuen Fänge mitbringen, habe ich ihm gesagt. Ich esse lieber Fisch aus dem
Supermarkt. Da war über sein Gesicht ein dunkler Schatten gehuscht. Der Glanz aus seinen Augen
war verschwunden und er sagte, bevor er sich umdrehte und ging, dann hast du sie wohl falsch
zubereitet.
Die Frau Doktor des Hauses, indem ich gezwungen bin mich aufzuhalten, erinnert mich an meine
erste Freundin. Auch ihre Augen scheinen etwas an mir zu suchen, wie damals Brittas Augen. So
hieß das Mädchen, dass ich zu mir auf mein Zimmer genommen hatte. Ich wollte ihr meine
Briefmarkensammlung zeigen. Britta hatte sich wochenlang geziert mitzukommen. Das fand ich
albern. Aber sie gefiel mir und so brachte ich schon mal das eine oder andere Album aus meiner
Sammlung mit in die Schule. Ich war ein begeisterter, ein besessener Sammler, wenn auch die
Stücke, die ich hatte, ohne großen Wert waren. Mein Ziel war es, aus möglichst allen Ländern der
Erde möglichst viele verschiedene Marken zu bekommen.
Endlich war es soweit. Britta wollte auf einen Nachmittag mitkommen, denn sie war wohl
inzwischen von meinen Marken angetan. Nun saß sie auf der kleinen bequemen Kautsch neben
mir. Wir blätterten in meinen Alben als mir ein riesiger Schreck durch die Glieder fuhr. Britta hatte
immer wieder meine linke Hand gestreichelt, mit der ich die Seiten der Alben umblätterte (die Hand,
die heute als Klosettdeckel bezeichnet wird. Damals aber war sie noch normal und jugendlich zart).
Der Schreck schien sich auf Britta übertragen zu haben, denn sie hielt mit ihrem Streicheln inne
und schaute mir fragend ins Gesicht. Oder war ihr Blick erwartungsvoll? Jedenfalls fieberte es in
meinem inneren, denn drei meiner schönsten Alben fehlten. Wo hatte ich sie gelassen? Waren sie
versehentlich mit in die Kiste meiner alten Kinder- und Jugendbücher geraten, die ich verschenkt
hatte? Ich erklärte Britta, das ich sofort wieder käme und ging hinab in den Keller, wo ich nach
einigem suchen zu meiner großen Erleichterung die Alben fand. Als ich zurück in mein Zimmer kam
heftete mein Blick sich sofort auf die beiden festen Brüste. War es Britta in meinem Zimmer zu
warm geworden?
Daß oberste Album stürzte polternd zu Boden. Britta hatte nicht nur ihren Pullover ausgezogen. Ich
sank auf den Knien und sammelte verwirrt die Marken ein. Stück für Stück während Britta auf der
Couch saß und mir zu schaute. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie sie mich musterte. Es
war der gleiche Blick, mit dem mich nun die Ärztin anschaut. Als suche sie etwas in mir zu
ergründen, dabei waren es doch nur die Briefmarken, die ich weder geknickt noch anders
beschädigt haben wollte. Britta aber war plötzlich rot im Gesicht geworden. So schnell es ging
schlüpfte sie in ihre Kleider, stieß sich dabei mehrmals an dem Tisch, der vor der Couch stand, und
noch ehe ich etwas zu sagen wusste, hatte sie mein Zimmer verlassen und war aus der Wohnung
gestürmt.
Hammer ist übrigens nicht gleich Hammer! Das sollten sie wissen. Der Hammer ist ein
Schlagwerkzeug mit unterschiedlicher Größe und Bauform je nach Verwendung. Der bekannteste
Hammer, weil er in jedem Werkzeugkasten zu finden ist, dürfte der Schlosserhammer sein. Nägel
werden mit ihm in die Wand getrieben, oder es wird mit ihm etwas krumm oder kaputt geschlagen.
Für letzteres ist allerdings besser der Vorschlaghammer zu gebrauchen. Schon allein, weil sein
Hammerkopf massiver ist. Weniger bekannt sind dagegen der Sickenhammer, der
Schusterhammer, Maurerhammer, Schreinerhammer, Ballhammer, Sehlichthammer,
Kesselsteinhammer, Lattenhammer, Geologenhammer und der Steinhauerschlegel. Es sind
Hämmer für spezielle Anwendungsfälle, - wie ja ihre Namen schon andeuten. Der Holzhammer
wiederum dürfte bekannt sein. Unter den Hämmern ist er etwas besonderes. Denn nicht nur sein
Stiel ist wie bei allen Hämmern aus Holz, sondern auch sein Hammerkopf. Er ist zudem bauchig,
wie ein Bierfass. Mein Holzhammer war in der Mitte des Kopfes, dort wo Stiel und Kopf
zusammengesetzt sind, von einem breiten Metallring umfasst. Der Ring soll verhindern, dass der
Hammerkopf im Laufe der Zeit sich weitet oder gar auseinander platzt. Nicht bei jeder Anwendung
ist das aber der Fall. So wie ich den Hammer im Gebrauch hatte, wäre sein Kopf niemals
auseinander geplatzt.
Der Kopf des Holzhammers ist aus Holz um zu vermeiden, dass das zu bearbeitende Material
Schaden nimmt. Der Schlag soll mehr in die Fläche, in den Raum des Materials wirken, als
unmittelbar an der Aufschlagstelle. Das Material lässt sich so in die breite Treiben. Bleche können
zum Beispiel geformt werden ohne das an der Aufschlagstelle harte Spuren zurückbleiben.
Mein Holzhammer hatte nicht in einer Werkzeugkiste gelegen. Er hing in meinem Wohnzimmer an
der Wand. Genauer gesagt auf einem quadratischen Brett, das mit dunkelbraunem Samt
überzogen war. Dieses Brett hatte zufällig die gleiche Größe wie das Fenster des Raumes, indem
ich nun auf einer Pritsche liege und in den Himmel schaue oder auf die weißen Wände. Kleine
Holzstifte, ebenfalls braun, arretierten den Hammer so, dass sein Kopf in die obere linke Ecke
zeigte, während sein Stiel nach unten in die rechte Ecke wies. So hing er schräg auf dem Brett und
verursachte bei den meisten Betrachtern dieser Anordnung die Vorstellung, es handele sich um ein
modernes Kunstwerk. Natürlich fiel er allen Besuchern in meiner Wohnung auf, aber nicht als etwas
so ungewöhnliches wie meine linke Hand.
Das mein Holzhammer sauber war, die natürliche Farbe seines Holzes frisch, der Metallring ohne
die geringste Spur von Patina, erwähne ich nur der Vollständigkeit halber. Der Hammer sah immer
aus wie neu, ja, wie mehr als neu: eben wie ein Kunstwerk, wenn es auch ein leichtes war ihn
abzunehmen und regelmäßig zu gebrauchen.
Aus der unteren Etage höre ich Schreie. Gutturale, verquere Schreie. Sie beunruhigen mich. Ist es
das, was die Ärztin an mir sucht? Unruhe und Abweichung?
Ich schreie nicht. Ich schaue aus dem Fenster und frage mich, was normal ist. Unten sind die
Schreienden nicht normal - heißt es.
Mein Nachbar ist in einem Club. Er ist ein Waffennarr. Er sammelte Waffen und er schießt gerne.
Natürlich ist er in einem Schützenverein. Vor allem aber ist er in diesem Club. Ich glaube, dieser
Sport - so sagt man doch? - ist wie so vieles von Amerika gekommen. Es ist ein Kriegsclub. So
nenne ich ihn, denn den richtigen Namen kenne ich nicht. Mein Nachbar fährt mit seinen
Clubkameraden fast jedes Wochenende zu einem brachliegenden Gelände. Der Club hat es
gepachtet und eingezäunt. Dort spielen sie Krieg. Richtig mit militärischem Drill, mit
Phantasieuniform und Gewehren, die mit Farbpatronen schießen und auf den Uniformen rote
Flecken hinterlassen. Natürlich rote. Sie markieren so einen Treffer. Kameraden, die getroffen
wurden, scheiden aus.
Mein Nachbar spielt Woche für Woche Krieg. Kurz bevor mir mein Hammer weggenommen wurde,
ist er vierzig Jahre alt geworden. Zu seiner Geburtstagsfeier bin ich nicht eingeladen worden. Zum
ersten Mal.
Der Drill sei hart, sagt er. Wie beim Militär. Vielleicht noch härter. Alle haben sie Spaß daran. Sie
toben sich aus, sie bauen - Frieden schaffend - ihre Aggressionen ab ohne andere Menschen zu
gefährden, andere Menschen zu schädigen. Das sagt mein Nachbar. Er spielt Krieg, um einen
anderen Autofahrer nicht in seiner Wut zu schlagen, so erklärt er. Besser die Menschen spielten
Krieg, als das sie ihn - und wenn nur im banalen Alltag - richtig führten.
Mein Nachbar muß nicht auf einer Pritsche liegen und durch ein quadratisches Fenster in den
dunkler werdenden Himmel schauen. Mein Nachbar sagt, gäbe es richtigen Krieg, wären er und
seine Kameraden vielleicht die besseren Soldaten.
Das erste Mal war es ein Versehen. Meine Hand schmerzte, dass es kaum auszuhalten war. Sie tat
mir tagelang weh. Und sie war nicht richtig zu gebrauchen. Ich bin aber nicht zum Arzt gegangen.
Ich hatte das Gefühl, nicht gehen zu brauchen; das sich alles von selbst ergeben würde und damit
hatte ich recht. Das tat mir gut. Gerade zu jener Zeit, denn man hatte mich nicht befördert. Es
waren Stellen eingespart worden. Direkt vor meiner Nase weg. Ich stand an der Ampel in einem
Pulk von Menschen und fühlte mich wie eine dumme kleine Ameise, die jeden Augenblick von
einem dämlichen Huhn versehentlich auf gepickt werden konnte. Ich fühlte mich klein und
bedeutungslos. Da tat es gut, recht behalten zu haben und nicht zum Arzt gegangen zu sein, wie es
alle wegen meiner geschwollenen Hand dringend empfahlen.
Den Hammer hatte ich in den Müll geschmissen, aus Wut und Verärgerung. Dabei konnte ER doch
nichts dafür. Als der Schmerz nachgelassen hatte, kaufte ich mir einen Neuen. Den Hammer, dem
ich dann eine quadratische Tafel baute; mit braunen Samt bezogen und, der wie ein Kunstwerk in
meinem Wohnzimmer an der Wand hing. Meine Verlobte verließ mich zu jener Zeit. Ich habe ihr nur
kurz nach getrauert.
Zunächst dachte ich, es wären Anschläge gewesen. Fanatische Feinde des Autos hätten des
Nachts auf dem kostbaren Lack die Kleckse mit aggressiver Farbe hinterlassen. Bei einigen sah es
auch so aus, als wenn sie ihren Wagen unter einer Stromleitung geparkt hätten, auf der ein riesiger
Vogel gesessen war und der seine Hinterlassenschaft ziel gerecht hatte fallen lassen. Ja, so sahen
die meisten Kleckse eigentlich auch aus. Wie ein riesiger, nach allen Seiten dick zerfließender
Vogelschiss! Erst als mein Bruder zu Besuch kam bin ich dahinter gekommen. Oh Gott dachte ich
zunächst, als ich seinen neuen Wagen sah; auch er hat so einen Anschlag ertragen müssen. War
aber nicht so. Mein Bruder lachte und zeigte mir, dass die Kleckse nur Folien waren, die leicht
wieder abgenommen werden konnte. Ist mal etwas anderes, erklärte er mir. Nicht nur so das
uniforme Aussehen der Wagen, alle gleich, sondern etwas Individuelles. Das hatte ich allerdings
nicht verstanden, wo doch immer mehr Autos mit diesen individuellen Klecksen herum fuhren.
Als mein Bruder abgereist war, freute ich mich auf meinen Hammer, dessen Gegenwart im
Wohnzimmer von ihm als unpassend empfunden wurde. Aber war mein Hammer, meine
Holzhammermethode nicht wirklich etwas individuelles; etwas, das nicht von der Stange weg im
Laden gekauft werden konnte, wie diese Kleckse, die Individualität signalisieren sollten?
Als Unterlage benutze ich übrigens eine zwei Zentimeter starke Korkplatte. Dort lege ich meine
linke Hand drauf. Die Ärztin konnte übrigens an dem Verhalten der Autofahrer mit den Klecksen
nichts besonderes finden. Ein Kollege von ihr hatte selbst viele Monate einen fetten Gelben auf
dem Kotflügel eines dunkelroten Wagens der oberen Preisklasse spazieren gefahren.
Mein linker Arm wurde dabei immer warm. Das gleichermaßen schmerzhafte wie vertraute Gefühl
zog oft bis in den Ellbogen. Es hat Jahre gedauert, bis die Hand ihre heutige Form angenommen
hat. Jetzt sitze ich auf meine Pritsche und starre die Hand an. Wenn ich hier noch lange sitzen
bleiben muß und meinen Holzhammer nicht zurück bekomme, befürchte ich, dass die Hand ihr
Aussehen und ihre einzigartige Form verliert. Die zurückliegenden Jahre wären vergeblich
gewesen. Die Ärztin aber sagt dazu nichts sondern schaut nur. Hätte ich Britta damals vielleicht
streicheln und küssen sollen, anstatt die Briefmarken aufzusammeln?
Vor nicht langer Zeit sah ich meine Verlobte - meine ehemalige. Sie war nicht allein. Mit ihren
Kolleginnen bummelte sie über den Jahrmarkt. Ein gackernder Frauenclub. Sie hatte mich nicht
gesehen, aber ich konnte beobachten wie sie sich wiegen ließ, wie sie etwas unterschrieb, - sie
wird doch nicht ...
Ja, sie ist unternehmungslustig. Sie mag das Prickeln einer Herausforderung, sie ist auf der Höhe
der Zeit. Und mir wird schon beim Blick über das Geländer im Treppenhaus unserer Firma
schwindelig. Aber sie ließ sich das Geschirr anlegen, nochmals wiegen und dann wurde sie in
einem Korb von dem Kran in die Höhe gehievt. Fünfzig Meter, stand an dem Schild nahe der Bude,
bei der sich die Wagemutigen melden konnten.
Ich sah sie in die Höhe entschwinden. Kräftige weiße Wolken, die im Sonnenlicht leuchteten,
malten den Hintergrund aus. Mir wurde schlecht. Ich eilte schleunigst in eine nahe liegende Kneipe,
hockte mich an die Theke, bestellte einen Doppelten und kippte ihn hinunter. Neben mir saßen
Zwei, die wohl schon lange an der Theke gehockt hatten. Einer stand auf, torkelte zur Tür und
stellte sich in den offenen Eingang. Uiii! grölte er, die hat aber Mut! Mit wehenden Haaren!
Draußen klatschten die Zuschauer. Ich bestellte noch einen Doppelten.
Zack - zack - zack - Wahnsinn - nichts als der helle Wahnsinn - dieser Schmerz - immer wieder
dieser Schmerz - mir steht der Schweiß auf der Stirn - es ist wahnsinnig - ein wahnsinniges Gefühl!
Oft bin ich danach ganz erschöpft und ich werde müde.
Einige Male habe ich schon früh Morgens den Hammer vom Brett geholt. Üblich war es nicht. Aber
ich hatte die Nachrichten im Radio gehört: eine Litanei des Wahnsinn. Die gemeldeten Toten waren
nicht zu zählen: und auch sonst. Später habe ich mich krank gemeldet für den Tag. Nicht wegen der
Hand! Wegen den Kollegen. Sie wollten es ja nicht verstehen.
Meine Methode hat mir geholfen zurecht zu kommen. Sie war etwas Eigenes, wirklich Eigenes, auf
das ich Stolz sein kann. Wenn ich in Amerika leben würde, glaube ich, hätte ich größere Chance
von immer mehr Menschen verstanden zu werden. Amerika ist doch das Land der unbegrenzten
Möglichkeiten. So aber bin ich ein Prophet, der im eigenen Land nichts gilt. Das habe ich der Ärztin
gesagt. Sie aber hat nur geschaut.
Im Fensterquadrat ist es nun dunkel geworden. Ich kann den Abendstern sehen. Wie schön er in
dem Viereck zur Geltung kommt. Es ist übrigens eine Sie, die Venus. Sie macht sich genauso wie
mein Hammer auf seinem samt bezogenen Quadrat. Wunderschön. Und so ist sie mir Trost in
meinem jetzigen Leben.
In der unteren Etage schreit jemand. Fürchterlich. Manchmal wird mein linker Arm warm, einfach so
- ohne Grund. Obwohl sie mir meinen Hammer weggenommen haben.
(c) Klaus Dieter Schley
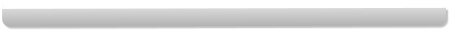
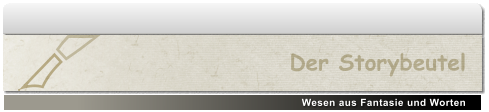
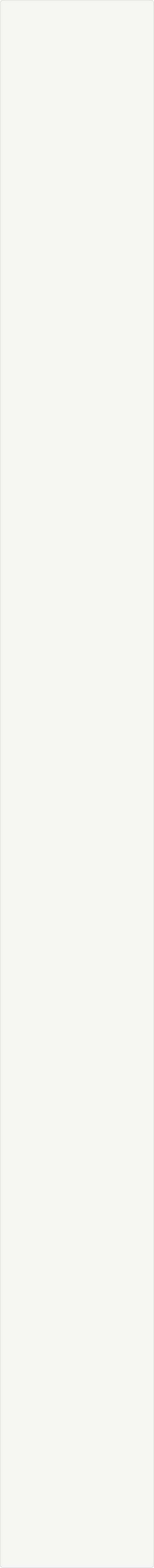
Die Hammermethode
Nun haben sie mir den Hammer weggenommen.
Alles hätten sie mir wegnehmen können, nur
nicht meinen geliebten Hammer.
Stundenlang sitze ich da und starre auf die
Wand. Die Wand ist weiß. Und dann lege ich
mich auf meine Pritsche und schaue durch das
Fenster in den Himmel. Gestern abend war er
dunkelblau. Ein kleines Flugzeug zog brummend
langsam von der rechten oberen zur linken
unteren Ecke. Am Heck blinkte ein weißes Licht.
Das war schön. Ganz unvermutet war das
Flugzeug in dem Fensterquadrat aufgetaucht.
Und nur wenige Sekunden brauchte es um das
Fenster zu durchqueren. Eine Träne löste sich
aus meinem Auge und lief heiß die Wange hinab, dicht am äußersten
Mundwinkel vorbei zum Kinn. Ich war glücklich.
Meine linke Hand ist vernarbt und verknorpelt. Natürlich, wie sollte sie
auch anders? Sie ist auch größer als die rechte Hand. Nicht unbedingt
dicker, eher breiter, großflächiger. Ein verknorpelter Toilettendeckel als
Hand, hatte mir ein Kollege gesagt. Er konnte es nicht verstehen und war
mit seinem Unverständnis nicht allein. Denn niemand versteht mich.
Mein Kollege fährt jedes Wochenende mit seinem Wohnmobil an einen
kleinen See und angelt. Er und seine Freunde angeln soviel, dass sie
ihren Fang eigentlich nicht selbst essen können. So hat er mir auch
einmal ein paar schöne Fische mitgegeben. Einige Tage später fragte er
mich, wie sie geschmeckt hätten. Seine Augen glänzten, als er mich dies
fragte. Mir aber waren die Fische nicht bekommen. Sie schienen mir
etwas faulig zu schmecken, wie Morast. Deshalb brauchte er mir auch
keine neuen Fänge mitbringen, habe ich ihm gesagt. Ich esse lieber
Fisch aus dem Supermarkt. Da war über sein Gesicht ein dunkler
Schatten gehuscht. Der Glanz aus seinen Augen war verschwunden und
er sagte, bevor er sich umdrehte und ging, dann hast du sie wohl falsch
zubereitet.
Die Frau Doktor des Hauses, indem ich gezwungen bin mich aufzuhalten,
erinnert mich an meine erste Freundin. Auch ihre Augen scheinen etwas
an mir zu suchen, wie damals Brittas Augen. So hieß das Mädchen, dass
ich zu mir auf mein Zimmer genommen hatte. Ich wollte ihr meine
Briefmarkensammlung zeigen. Britta hatte sich wochenlang geziert
mitzukommen. Das fand ich albern. Aber sie gefiel mir und so brachte ich
schon mal das eine oder andere Album aus meiner Sammlung mit in die
Schule. Ich war ein begeisterter, ein besessener Sammler, wenn auch die
Stücke, die ich hatte, ohne großen Wert waren. Mein Ziel war es, aus
möglichst allen Ländern der Erde möglichst viele verschiedene Marken
zu bekommen.
Endlich war es soweit. Britta wollte auf einen Nachmittag mitkommen,
denn sie war wohl inzwischen von meinen Marken angetan. Nun saß sie
auf der kleinen bequemen Kautsch neben mir. Wir blätterten in meinen
Alben als mir ein riesiger Schreck durch die Glieder fuhr. Britta hatte
immer wieder meine linke Hand gestreichelt, mit der ich die Seiten der
Alben umblätterte (die Hand, die heute als Klosettdeckel bezeichnet wird.
Damals aber war sie noch normal und jugendlich zart). Der Schreck
schien sich auf Britta übertragen zu haben, denn sie hielt mit ihrem
Streicheln inne und schaute mir fragend ins Gesicht. Oder war ihr Blick
erwartungsvoll? Jedenfalls fieberte es in meinem inneren, denn drei
meiner schönsten Alben fehlten. Wo hatte ich sie gelassen? Waren sie
versehentlich mit in die Kiste meiner alten Kinder- und Jugendbücher
geraten, die ich verschenkt hatte? Ich erklärte Britta, das ich sofort wieder
käme und ging hinab in den Keller, wo ich nach einigem suchen zu
meiner großen Erleichterung die Alben fand. Als ich zurück in mein
Zimmer kam heftete mein Blick sich sofort auf die beiden festen Brüste.
War es Britta in meinem Zimmer zu warm geworden?
Daß oberste Album stürzte polternd zu Boden. Britta hatte nicht nur ihren
Pullover ausgezogen. Ich sank auf den Knien und sammelte verwirrt die
Marken ein. Stück für Stück während Britta auf der Couch saß und mir zu
schaute. Aus den Augenwinkeln nahm ich wahr, wie sie mich musterte.
Es war der gleiche Blick, mit dem mich nun die Ärztin anschaut. Als
suche sie etwas in mir zu ergründen, dabei waren es doch nur die
Briefmarken, die ich weder geknickt noch anders beschädigt haben
wollte. Britta aber war plötzlich rot im Gesicht geworden. So schnell es
ging schlüpfte sie in ihre Kleider, stieß sich dabei mehrmals an dem
Tisch, der vor der Couch stand, und noch ehe ich etwas zu sagen
wusste, hatte sie mein Zimmer verlassen und war aus der Wohnung
gestürmt.
Hammer ist übrigens nicht gleich Hammer! Das sollten sie wissen. Der
Hammer ist ein Schlagwerkzeug mit unterschiedlicher Größe und
Bauform je nach Verwendung. Der bekannteste Hammer, weil er in jedem
Werkzeugkasten zu finden ist, dürfte der Schlosserhammer sein. Nägel
werden mit ihm in die Wand getrieben, oder es wird mit ihm etwas krumm
oder kaputt geschlagen. Für letzteres ist allerdings besser der
Vorschlaghammer zu gebrauchen. Schon allein, weil sein Hammerkopf
massiver ist. Weniger bekannt sind dagegen der Sickenhammer, der
Schusterhammer, Maurerhammer, Schreinerhammer, Ballhammer,
Sehlichthammer, Kesselsteinhammer, Lattenhammer, Geologenhammer
und der Steinhauerschlegel. Es sind Hämmer für spezielle
Anwendungsfälle, - wie ja ihre Namen schon andeuten. Der Holzhammer
wiederum dürfte bekannt sein. Unter den Hämmern ist er etwas
besonderes. Denn nicht nur sein Stiel ist wie bei allen Hämmern aus
Holz, sondern auch sein Hammerkopf. Er ist zudem bauchig, wie ein
Bierfass. Mein Holzhammer war in der Mitte des Kopfes, dort wo Stiel
und Kopf zusammengesetzt sind, von einem breiten Metallring umfasst.
Der Ring soll verhindern, dass der Hammerkopf im Laufe der Zeit sich
weitet oder gar auseinander platzt. Nicht bei jeder Anwendung ist das
aber der Fall. So wie ich den Hammer im Gebrauch hatte, wäre sein Kopf
niemals auseinander geplatzt.
Der Kopf des Holzhammers ist aus Holz um zu vermeiden, dass das zu
bearbeitende Material Schaden nimmt. Der Schlag soll mehr in die
Fläche, in den Raum des Materials wirken, als unmittelbar an der
Aufschlagstelle. Das Material lässt sich so in die breite Treiben. Bleche
können zum Beispiel geformt werden ohne das an der Aufschlagstelle
harte Spuren zurückbleiben.
Mein Holzhammer hatte nicht in einer Werkzeugkiste gelegen. Er hing in
meinem Wohnzimmer an der Wand. Genauer gesagt auf einem
quadratischen Brett, das mit dunkelbraunem Samt überzogen war.
Dieses Brett hatte zufällig die gleiche Größe wie das Fenster des
Raumes, indem ich nun auf einer Pritsche liege und in den Himmel
schaue oder auf die weißen Wände. Kleine Holzstifte, ebenfalls braun,
arretierten den Hammer so, dass sein Kopf in die obere linke Ecke zeigte,
während sein Stiel nach unten in die rechte Ecke wies. So hing er schräg
auf dem Brett und verursachte bei den meisten Betrachtern dieser
Anordnung die Vorstellung, es handele sich um ein modernes Kunstwerk.
Natürlich fiel er allen Besuchern in meiner Wohnung auf, aber nicht als
etwas so ungewöhnliches wie meine linke Hand.
Das mein Holzhammer sauber war, die natürliche Farbe seines Holzes
frisch, der Metallring ohne die geringste Spur von Patina, erwähne ich nur
der Vollständigkeit halber. Der Hammer sah immer aus wie neu, ja, wie
mehr als neu: eben wie ein Kunstwerk, wenn es auch ein leichtes war ihn
abzunehmen und regelmäßig zu gebrauchen.
Aus der unteren Etage höre ich Schreie. Gutturale, verquere Schreie. Sie
beunruhigen mich. Ist es das, was die Ärztin an mir sucht? Unruhe und
Abweichung?
Ich schreie nicht. Ich schaue aus dem Fenster und frage mich, was
normal ist. Unten sind die Schreienden nicht normal - heißt es.
Mein Nachbar ist in einem Club. Er ist ein Waffennarr. Er sammelte
Waffen und er schießt gerne. Natürlich ist er in einem Schützenverein.
Vor allem aber ist er in diesem Club. Ich glaube, dieser Sport - so sagt
man doch? - ist wie so vieles von Amerika gekommen. Es ist ein
Kriegsclub. So nenne ich ihn, denn den richtigen Namen kenne ich nicht.
Mein Nachbar fährt mit seinen Clubkameraden fast jedes Wochenende
zu einem brachliegenden Gelände. Der Club hat es gepachtet und
eingezäunt. Dort spielen sie Krieg. Richtig mit militärischem Drill, mit
Phantasieuniform und Gewehren, die mit Farbpatronen schießen und auf
den Uniformen rote Flecken hinterlassen. Natürlich rote. Sie markieren so
einen Treffer. Kameraden, die getroffen wurden, scheiden aus.
Mein Nachbar spielt Woche für Woche Krieg. Kurz bevor mir mein
Hammer weggenommen wurde, ist er vierzig Jahre alt geworden. Zu
seiner Geburtstagsfeier bin ich nicht eingeladen worden. Zum ersten Mal.
Der Drill sei hart, sagt er. Wie beim Militär. Vielleicht noch härter. Alle
haben sie Spaß daran. Sie toben sich aus, sie bauen - Frieden schaffend
- ihre Aggressionen ab ohne andere Menschen zu gefährden, andere
Menschen zu schädigen. Das sagt mein Nachbar. Er spielt Krieg, um
einen anderen Autofahrer nicht in seiner Wut zu schlagen, so erklärt er.
Besser die Menschen spielten Krieg, als das sie ihn - und wenn nur im
banalen Alltag - richtig führten.
Mein Nachbar muß nicht auf einer Pritsche liegen und durch ein
quadratisches Fenster in den dunkler werdenden Himmel schauen. Mein
Nachbar sagt, gäbe es richtigen Krieg, wären er und seine Kameraden
vielleicht die besseren Soldaten.
Das erste Mal war es ein Versehen. Meine Hand schmerzte, dass es
kaum auszuhalten war. Sie tat mir tagelang weh. Und sie war nicht richtig
zu gebrauchen. Ich bin aber nicht zum Arzt gegangen. Ich hatte das
Gefühl, nicht gehen zu brauchen; das sich alles von selbst ergeben
würde und damit hatte ich recht. Das tat mir gut. Gerade zu jener Zeit,
denn man hatte mich nicht befördert. Es waren Stellen eingespart
worden. Direkt vor meiner Nase weg. Ich stand an der Ampel in einem
Pulk von Menschen und fühlte mich wie eine dumme kleine Ameise, die
jeden Augenblick von einem dämlichen Huhn versehentlich auf gepickt
werden konnte. Ich fühlte mich klein und bedeutungslos. Da tat es gut,
recht behalten zu haben und nicht zum Arzt gegangen zu sein, wie es alle
wegen meiner geschwollenen Hand dringend empfahlen.
Den Hammer hatte ich in den Müll geschmissen, aus Wut und
Verärgerung. Dabei konnte ER doch nichts dafür. Als der Schmerz
nachgelassen hatte, kaufte ich mir einen Neuen. Den Hammer, dem ich
dann eine quadratische Tafel baute; mit braunen Samt bezogen und, der
wie ein Kunstwerk in meinem Wohnzimmer an der Wand hing. Meine
Verlobte verließ mich zu jener Zeit. Ich habe ihr nur kurz nach getrauert.
Zunächst dachte ich, es wären Anschläge gewesen. Fanatische Feinde
des Autos hätten des Nachts auf dem kostbaren Lack die Kleckse mit
aggressiver Farbe hinterlassen. Bei einigen sah es auch so aus, als wenn
sie ihren Wagen unter einer Stromleitung geparkt hätten, auf der ein
riesiger Vogel gesessen war und der seine Hinterlassenschaft ziel
gerecht hatte fallen lassen. Ja, so sahen die meisten Kleckse eigentlich
auch aus. Wie ein riesiger, nach allen Seiten dick zerfließender
Vogelschiss! Erst als mein Bruder zu Besuch kam bin ich dahinter
gekommen. Oh Gott dachte ich zunächst, als ich seinen neuen Wagen
sah; auch er hat so einen Anschlag ertragen müssen. War aber nicht so.
Mein Bruder lachte und zeigte mir, dass die Kleckse nur Folien waren, die
leicht wieder abgenommen werden konnte. Ist mal etwas anderes,
erklärte er mir. Nicht nur so das uniforme Aussehen der Wagen, alle
gleich, sondern etwas Individuelles. Das hatte ich allerdings nicht
verstanden, wo doch immer mehr Autos mit diesen individuellen Klecksen
herum fuhren.
Als mein Bruder abgereist war, freute ich mich auf meinen Hammer,
dessen Gegenwart im Wohnzimmer von ihm als unpassend empfunden
wurde. Aber war mein Hammer, meine Holzhammermethode nicht
wirklich etwas individuelles; etwas, das nicht von der Stange weg im
Laden gekauft werden konnte, wie diese Kleckse, die Individualität
signalisieren sollten?
Als Unterlage benutze ich übrigens eine zwei Zentimeter starke
Korkplatte. Dort lege ich meine linke Hand drauf. Die Ärztin konnte
übrigens an dem Verhalten der Autofahrer mit den Klecksen nichts
besonderes finden. Ein Kollege von ihr hatte selbst viele Monate einen
fetten Gelben auf dem Kotflügel eines dunkelroten Wagens der oberen
Preisklasse spazieren gefahren.
Mein linker Arm wurde dabei immer warm. Das gleichermaßen
schmerzhafte wie vertraute Gefühl zog oft bis in den Ellbogen. Es hat
Jahre gedauert, bis die Hand ihre heutige Form angenommen hat. Jetzt
sitze ich auf meine Pritsche und starre die Hand an. Wenn ich hier noch
lange sitzen bleiben muß und meinen Holzhammer nicht zurück
bekomme, befürchte ich, dass die Hand ihr Aussehen und ihre
einzigartige Form verliert. Die zurückliegenden Jahre wären vergeblich
gewesen. Die Ärztin aber sagt dazu nichts sondern schaut nur. Hätte ich
Britta damals vielleicht streicheln und küssen sollen, anstatt die
Briefmarken aufzusammeln?
Vor nicht langer Zeit sah ich meine Verlobte - meine ehemalige. Sie war
nicht allein. Mit ihren Kolleginnen bummelte sie über den Jahrmarkt. Ein
gackernder Frauenclub. Sie hatte mich nicht gesehen, aber ich konnte
beobachten wie sie sich wiegen ließ, wie sie etwas unterschrieb, - sie
wird doch nicht ...
Ja, sie ist unternehmungslustig. Sie mag das Prickeln einer
Herausforderung, sie ist auf der Höhe der Zeit. Und mir wird schon beim
Blick über das Geländer im Treppenhaus unserer Firma schwindelig.
Aber sie ließ sich das Geschirr anlegen, nochmals wiegen und dann
wurde sie in einem Korb von dem Kran in die Höhe gehievt. Fünfzig
Meter, stand an dem Schild nahe der Bude, bei der sich die Wagemutigen
melden konnten.
Ich sah sie in die Höhe entschwinden. Kräftige weiße Wolken, die im
Sonnenlicht leuchteten, malten den Hintergrund aus. Mir wurde schlecht.
Ich eilte schleunigst in eine nahe liegende Kneipe, hockte mich an die
Theke, bestellte einen Doppelten und kippte ihn hinunter. Neben mir
saßen Zwei, die wohl schon lange an der Theke gehockt hatten. Einer
stand auf, torkelte zur Tür und stellte sich in den offenen Eingang. Uiii!
grölte er, die hat aber Mut! Mit wehenden Haaren!
Draußen klatschten die Zuschauer. Ich bestellte noch einen Doppelten.
Zack - zack - zack - Wahnsinn - nichts als der helle Wahnsinn - dieser
Schmerz - immer wieder dieser Schmerz - mir steht der Schweiß auf der
Stirn - es ist wahnsinnig - ein wahnsinniges Gefühl! Oft bin ich danach
ganz erschöpft und ich werde müde.
Einige Male habe ich schon früh Morgens den Hammer vom Brett geholt.
Üblich war es nicht. Aber ich hatte die Nachrichten im Radio gehört: eine
Litanei des Wahnsinn. Die gemeldeten Toten waren nicht zu zählen: und
auch sonst. Später habe ich mich krank gemeldet für den Tag. Nicht
wegen der Hand! Wegen den Kollegen. Sie wollten es ja nicht verstehen.
Meine Methode hat mir geholfen
zurecht zu kommen. Sie war etwas
Eigenes, wirklich Eigenes, auf das ich
Stolz sein kann. Wenn ich in Amerika
leben würde, glaube ich, hätte ich
größere Chance von immer mehr
Menschen verstanden zu werden.
Amerika ist doch das Land der
unbegrenzten Möglichkeiten. So aber
bin ich ein Prophet, der im eigenen
Land nichts gilt. Das habe ich der
Ärztin gesagt. Sie aber hat nur
geschaut.
Im Fensterquadrat ist es nun dunkel
geworden. Ich kann den Abendstern
sehen. Wie schön er in dem Viereck
zur Geltung kommt. Es ist übrigens
eine Sie, die Venus. Sie macht sich
genauso wie mein Hammer auf
seinem samt bezogenen Quadrat.
Wunderschön. Und so ist sie mir
Trost in meinem jetzigen Leben.
In der unteren Etage schreit jemand. Fürchterlich. Manchmal wird mein
linker Arm warm, einfach so - ohne Grund. Obwohl sie mir meinen
Hammer weggenommen haben.
(c) Klaus Dieter Schley