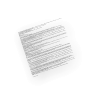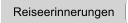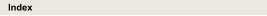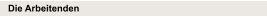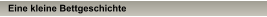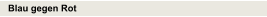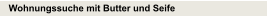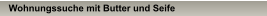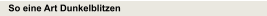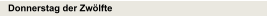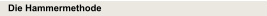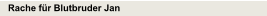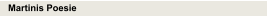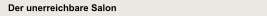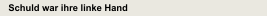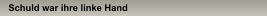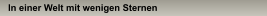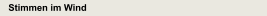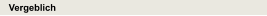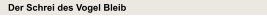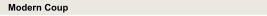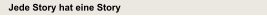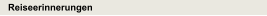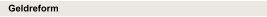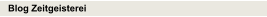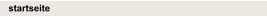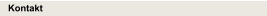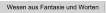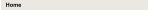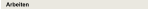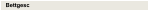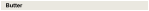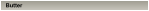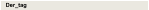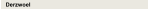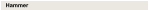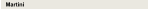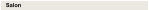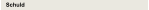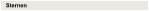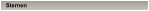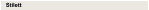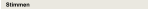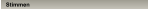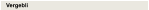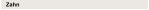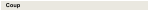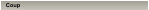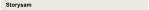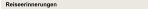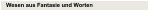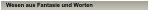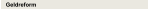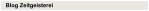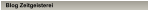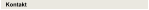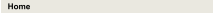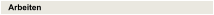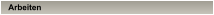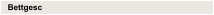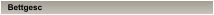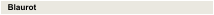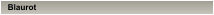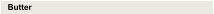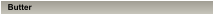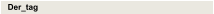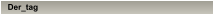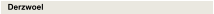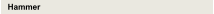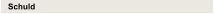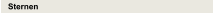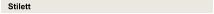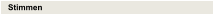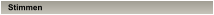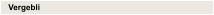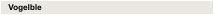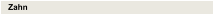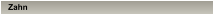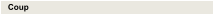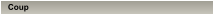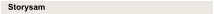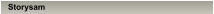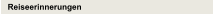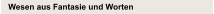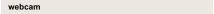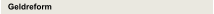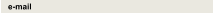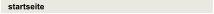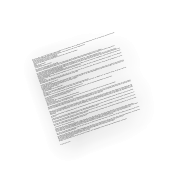


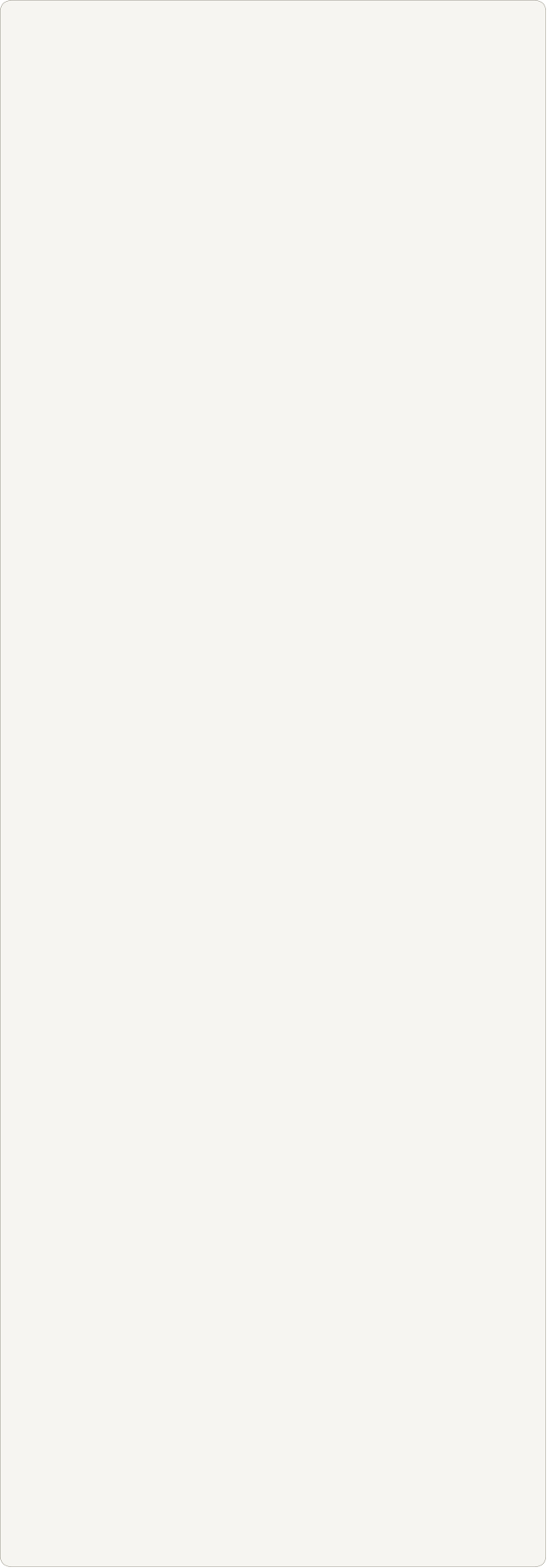
Eine seltsame Zahnbehandlung
Die Schmerzen waren so unerträglich geworden, daß ich meinen ganzen Mut zusammengefaßt
und um einen Termin bei meinem Zahnarzt gebeten hatte. Und nun war es soweit. Ich stand vor der
Praxistür und meine Hand ruhte auf dem Türgriff. Oh ja, am liebsten wäre ich auf der Stelle nach
Hause gefahren. Ich sehnte mich nach meinem Bett, in das ich mich nur zu gerne verkrochen hätte,
um in einen tiefen traumlosen Schlaf zu versinken. Denn nicht nur der Tag in der Firma war
anstrengend gewesen. Ich hatte ja schreckliche Nächte durchlitten. Aber gerade deshalb galt es
jetzt nicht zu kneifen, auch wenn mir schon der typische Geruch einer Zahnarztpraxis in der Nase
lag und plötzlich auch noch jenes pfeifende Geräusch anhob, das mir sogleich ein Grauen durch
den Körper jagte. Ich atmete also einmal kräftig durch, drückte die Tür auf und ging entschlossen
auf den Tresen der Anmeldung zu.
Während die Helferin meine Karteikarte suchte und meinen Namen auf ihrem Kalender durchstrich,
erinnerte ich mich der letzten Behandlung. Sie lag schon lange zurück. Dank Karies in einem
späten Stadium war sie sehr langwierig und schmerzhaft gewesen. Und das, obwohl mein Zahnarzt
sehr geschickt war und über eine sicher Hand verfügte. Aber auch der beste Zahnarzt wird keine
schmerzfreie Behandlung durchführen können bei einem so schlechten Patienten wie mir, der nur
kommt, wenn es nicht mehr anders geht. Ich mußte also wieder mit dem Schlimmsten rechnen.
"Sie haben Glück", sagte die junge Frau in der Anmeldung. "Sie können gleich in den
Behandlungsraum Zwei gehen."
In Nummer Zwei empfing mich die hübsche Helferin, deren mitfühlende Anteilnahme ich vom
letzten Mal noch in guter Erinnerung hatte. Zumindest das war ein Trost.
"Bitte setzen sie sich", sagte sie und zeigte auf den Behandlungsstuhl.
"Sie waren schon lange nicht mehr bei uns?" "Das mögen zwei Jahre sein."
"Sind Sie zum Nachschauen gekommen oder haben Sie Schmerzen?"
"Wegen Schmerzen. Sie sind aber schon wieder weg", beeilte ich mich zu sagen, als könnte ich
dadurch Gnade erlangen. Und es stimmte ja auch. Den ganzen Tag hatte ich keine Schmerzen
mehr gehabt, so daß ich schon daran gedachte hatte, den Termin abzusagen.
Die Helferin zeigte sich aber unbeeindruckt. Sie ließ den Behandlungsstuhl hochfahren und stellte
die Rückenlehne zurück, so das ich in eine bequeme, faßt horizontale Lage geriet. Dann legte sie
mir eine große Papierserviette unter das Kinn und paßte mir die Kopfstütze an. Anschließend
breitete sie das Behandlungsbesteck auf dem Tischchen aus, dabei ließ sie die verschiedensten
Bohrer einsatzbereit aus der Garage fahren. Verstohlen wagte ich einen Blick auf diese
unangenehmen Instrumente. Ihre Bereitschaft erschien mir wie eine heimtückische Drohung.
Zuletzt stellte sie noch ein Glas neben das Speichelbecken. Automatisch wurde es mit Wasser
gefüllt.
"Sie müssen sich noch einen Moment gedulden. Der Herr Doktor kommt gleich", sagte sie und
verließ den Raum. Da lag ich nun und hatte noch eine Galgenfrist.
Das Behandlungszimmer ging zum Hof hinaus. So waren die Straßengeräusche durch das
gekippte Fenster nur schwach zu hören. Umso deutlicher erklang der abendliche Gesang der
Vögel. Es war eine friedliche Ruhe. An den Wänden hingen Bilder mit Figuren aus der Welt von
Walt Disney. Micky Mouse erklärte den Umgang mit einer Zahnbürste. Sein Freund Goofy lief mit
einer geschwollenen Wange durch den Wald und jammerte schauderhaft. Er gelobte eine bessere
Zahnpflege. Füchse und Kaninchen bleckten ihre makellosen Zähne. Obwohl sich unter das
Vogelgezwitscher schwach die pfeifende Geräusche eines Bohrers mischten, störte ich mich daran
nicht mehr, sondern fand endlich etwas innere Ruhe.
Plötzlich stand der Zahnarzt vor mir. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie er den Raum betreten hatte.
Einen Augenblick schien es mir, als wenn er die ganze Zeit hinter mir gestanden hätte, um mich
heimlich zu beobachten. Doch was für ein unsinniger Gedanke.
Als er mich mit einem festen Handschlag begrüßte, war ich erschrocken über seine rauhe und
knochige Hand. Auch die hübsche Helferin trat jetzt unvermutet an ihren Platz.
"Sie haben Schmerzen?" fragt mich der Arzt während er meine Karteikarte studierte.
"Ja, oben rechts."
"Mhm", machte er. Sein runder Mund unter der überaus großen Nase verzerrte sich zu einem
schrägen Lächeln. Ich bemerkte, wie er mit der Helferin einen verständigen Blick tauschte. Selber
Schuld, wird er wohl denken. Warum kommst du auch nicht regelmäßig.
"Dann wollen wir mal", sagte er und schaltete die Behandlungslampe ein. Das Licht blendete mich.
"Mund auf", rief er und justierte mit ein paar ruppigen Griffen die Höhe des Behandlungsstuhles. Mit
einer Sonde und einem Mundspiegel erkundete er mein Gebiß. Er stach hier und kratzte dort,
klopfte mal von oben dann wieder von der Seite gegen die Zähne.
"Löcher, nichts als Löcher. Eine vollendete
Kraterlandschaft", raunte er. Ich preßte meine Hände auf die Stuhllehne und spürte, wie sich kalter
Schweiß auf meine Stirn sammelte.
"So ein kaputtes Gebiß haben wir schon lange nicht gesehen", sagte er zur Helferin. Die aber stand
nur stumm und reglos an ihrem Platz.
Nachdem er mein Gebiß erkundet hatte, richtete er sich auf und drehte die Lampe zur Seite. Erst
jetzt wurde ich gewahr, daß seine Nase überaus groß war, ja geradezu riesig und entstellt. Hatte er
einen Unfall gehabt? Ich konnte mich nicht entsinnen, daß mir bei früheren Behandlungen sein
Äußeres derart unangenehm aufgefallen war. Doch noch ehe ich dazu kam in meiner Erinnerung
weiter zu forschen, fiel mir die Spitze seiner Nase auf. Irgend etwas Helles schimmerte dort im
Licht.
"Da haben wir reichlich zu tun", sagte der Arzt und schreckte mich damit aus meinen
Beobachtungen auf. "Er ist für heute der letzte Patient", erklärte die Helferin.
"Dann haben wir ja schön viel Zeit", sagte er und rieb sich seine groben Hände. Die Helferin lachte.
Ihr fehlten oben und unten Schneidezähne. Und die anderen Zähne waren mehr gelb als weiß.
Durch Absplitterungen waren sie zudem verunstaltet. "Was für ein häßliches Gebiß", dachte ich und
war zugleich erschrocken wie enttäuscht.
Der Zahnarzt drehte die blendende Lampe zurück. Dann griff er zu einem Bohrer und hielt ihn mir
übers Gesicht. Die Helferin hielt
das Absaugröhrchen bereit. Jetzt ging es also los. Ich versuchte mich tiefer in den
Behandlungsstuhl zu drücken, als könnte ich dadurch dem Bohrer entweichen.
"Wenn es schmerzt müssen Sie die Hand heben", sagte er.
Ich öffnete meinen Mund und sie fuhren mit ihren Instrumenten in die Mundhöhle. Der Bohrer jaulte
auf. Er pfiff und quietschte, und sogleich schoß mir ein schauriges Gefühl durch Mark und Bein.
Das Absaugrohr röchelte, und Kühlwasser spritzte mir wie bei einem Springbrunnen aus dem
Rachen. Plötzlich befürchtete ich, daß der Bohrer in meinem Zahn stecken bleiben würde und
wollte meine Hand anheben. Aber in meinen Glieder war kein Gefühl mehr. Sie wollten mir nicht
gehorchen. Meine Hand blieb regungslos, wie tot, auf dem Leder des Stuhls liegen. Da nahm der
Arzt den Bohrer zu meiner Erleichterung heraus. Ich konzentrierte mich um ruhiger zu werden. Bloß
nicht schlapp machen, dachte ich. Es wird schon nicht so schlimm. Im blendenden Schein der
Lampe sah ich schemenhaft, wie er einen anderen Bohrer vorbereitete. Ein größeres, brummendes
Gerät. Und ehe ich mich versah schirmte seine riesige Nase das Licht, und ich schaute in die
häßlichen Augen des Arztes, die wiederum ganz in meinen Rachen versanken. Den brummenden
Bohrer drückte er hart an meinen Zahn. Sofort bebte mein ganzer Körper. Mit unüberwindbarer
Kraft preßte mich etwas auf den Stuhl. Doch was war das? An der Nasenspitze des Arztes
baumelte ein großer Tropfen, der das Licht in schillernden Farben brach. Dieser Tropfen schwebte
in drohender Lokkerheit über meinen aufgesperrten Rachen.
"Den Mund auf, weiter, weiter, Mensch, wie soll denn da einer rein kommen", rügte mich der Arzt.
Und die Helferin hebelte mit dem Absaugrohr an meinen Zähnen, daß ich schon fürchtete, gleich
bricht mir der Kiefer.
"Nein nicht!" wollte ich rufen, aber wie? Der Bohrer ruckelte in meinem Zahn, der Tropfen unter
Nasenspitze wuchs und wuchs, mein Kopf schlug gegen die Stütze, mein Körper wurde hin- und
her geschlagen, da löste sich der riesige Tropfen von der Nase und entsetzt schaute ich in das
lachende Gesicht der hübschen Helferin, die mich noch immer an der Schulter rüttelte.
"Haben Sie gut geruht?" fragte mich der Zahnarzt und reichte mir seine Hand.
"Entschuldigen Sie das es etwas länger gedauert hat. Aber sie haben ja die Zeit sinnvoll genutzt."
Von meinem Traum noch ganz benommen erwiderte ich seinen Handschlag.
(c) Klaus Dieter Schley
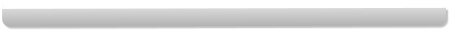
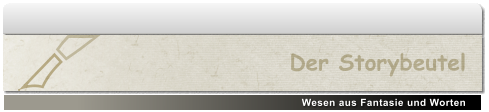
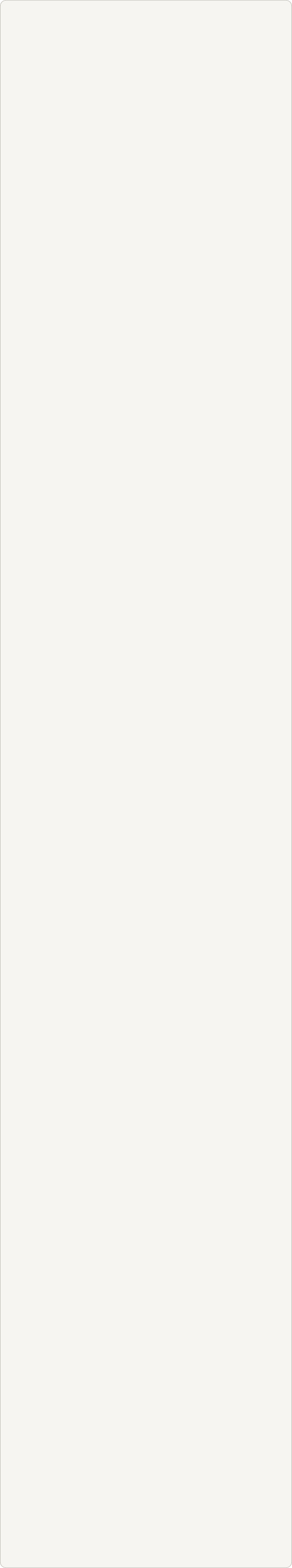
Eine seltsame Zahnbehandlung
Die Schmerzen waren so unerträglich
geworden, daß ich meinen ganzen Mut
zusammengefaßt und um einen Termin bei
meinem Zahnarzt gebeten hatte. Und nun war
es soweit. Ich stand vor der Praxistür und meine
Hand ruhte auf dem Türgriff. Oh ja, am liebsten
wäre ich auf der Stelle nach Hause gefahren.
Ich sehnte mich nach meinem Bett, in das ich
mich nur zu gerne verkrochen hätte, um in einen
tiefen traumlosen Schlaf zu versinken. Denn
nicht nur der Tag in der Firma war anstrengend
gewesen. Ich hatte ja schreckliche Nächte
durchlitten. Aber gerade deshalb galt es jetzt
nicht zu kneifen, auch wenn mir schon der
typische Geruch einer Zahnarztpraxis in der Nase lag und plötzlich auch
noch jenes pfeifende Geräusch anhob, das mir sogleich ein Grauen
durch den Körper jagte. Ich atmete also einmal kräftig durch, drückte die
Tür auf und ging entschlossen auf den Tresen der Anmeldung zu.
Während die Helferin meine Karteikarte suchte und meinen Namen auf
ihrem Kalender durchstrich, erinnerte ich mich der letzten Behandlung.
Sie lag schon lange zurück. Dank Karies in einem späten Stadium war
sie sehr langwierig und schmerzhaft gewesen. Und das, obwohl mein
Zahnarzt sehr geschickt war und über eine sicher Hand verfügte. Aber
auch der beste Zahnarzt wird keine schmerzfreie Behandlung
durchführen können bei einem so schlechten Patienten wie mir, der nur
kommt, wenn es nicht mehr anders geht. Ich mußte also wieder mit dem
Schlimmsten rechnen.
"Sie haben Glück", sagte die junge Frau in der Anmeldung. "Sie können
gleich in den Behandlungsraum Zwei gehen."
In Nummer Zwei empfing mich die hübsche Helferin, deren mitfühlende
Anteilnahme ich vom letzten Mal noch in guter Erinnerung hatte.
Zumindest das war ein Trost.
"Bitte setzen sie sich", sagte sie und zeigte auf den Behandlungsstuhl.
"Sie waren schon lange nicht mehr bei uns?" "Das mögen zwei Jahre
sein."
"Sind Sie zum Nachschauen gekommen oder haben Sie Schmerzen?"
"Wegen Schmerzen. Sie sind aber schon wieder weg", beeilte ich mich
zu sagen, als könnte ich dadurch Gnade erlangen. Und es stimmte ja
auch. Den ganzen Tag hatte ich keine Schmerzen mehr gehabt, so daß
ich schon daran gedachte hatte, den Termin abzusagen.
Die Helferin zeigte sich aber unbeeindruckt. Sie ließ den
Behandlungsstuhl hochfahren und stellte die Rückenlehne zurück, so
das ich in eine bequeme, faßt horizontale Lage geriet. Dann legte sie mir
eine große Papierserviette unter das Kinn und paßte mir die Kopfstütze
an. Anschließend breitete sie das Behandlungsbesteck auf dem
Tischchen aus, dabei ließ sie die verschiedensten Bohrer einsatzbereit
aus der Garage fahren. Verstohlen wagte ich einen Blick auf diese
unangenehmen Instrumente. Ihre Bereitschaft erschien mir wie eine
heimtückische Drohung. Zuletzt stellte sie noch ein Glas neben das
Speichelbecken. Automatisch wurde es mit Wasser gefüllt.
"Sie müssen sich noch einen Moment gedulden. Der Herr Doktor kommt
gleich", sagte sie und verließ den Raum. Da lag ich nun und hatte noch
eine Galgenfrist.
Das Behandlungszimmer ging zum Hof hinaus. So waren die
Straßengeräusche durch das gekippte Fenster nur schwach zu hören.
Umso deutlicher erklang der abendliche Gesang der Vögel. Es war eine
friedliche Ruhe. An den Wänden hingen Bilder mit Figuren aus der Welt
von Walt Disney. Micky Mouse erklärte den Umgang mit einer
Zahnbürste. Sein Freund Goofy lief mit einer geschwollenen Wange
durch den Wald und jammerte schauderhaft. Er gelobte eine bessere
Zahnpflege. Füchse und Kaninchen bleckten ihre makellosen Zähne.
Obwohl sich unter das Vogelgezwitscher schwach die pfeifende
Geräusche eines Bohrers mischten, störte ich mich daran nicht mehr,
sondern fand endlich etwas innere Ruhe.
Plötzlich stand der Zahnarzt vor mir. Ich hatte gar nicht bemerkt, wie er
den Raum betreten hatte. Einen Augenblick schien es mir, als wenn er
die ganze Zeit hinter mir gestanden hätte, um mich heimlich zu
beobachten. Doch was für ein unsinniger Gedanke.
Als er mich mit einem festen Handschlag begrüßte, war ich erschrocken
über seine rauhe und knochige Hand. Auch die hübsche Helferin trat jetzt
unvermutet an ihren Platz.
"Sie haben Schmerzen?" fragt mich der Arzt während er meine
Karteikarte studierte.
"Ja, oben rechts."
"Mhm", machte er. Sein runder Mund unter der überaus großen Nase
verzerrte sich zu einem schrägen Lächeln. Ich bemerkte, wie er mit der
Helferin einen verständigen Blick tauschte. Selber Schuld, wird er wohl
denken. Warum kommst du auch nicht regelmäßig.
"Dann wollen wir mal", sagte er und schaltete die Behandlungslampe ein.
Das Licht blendete mich.
"Mund auf", rief er und justierte mit ein paar ruppigen Griffen die Höhe
des Behandlungsstuhles. Mit einer Sonde und einem Mundspiegel
erkundete er mein Gebiß. Er stach hier und kratzte dort, klopfte mal von
oben dann wieder von der Seite gegen die Zähne.
"Löcher, nichts als Löcher. Eine vollendete
Kraterlandschaft", raunte er. Ich preßte meine Hände auf die Stuhllehne
und spürte, wie sich kalter Schweiß auf meine Stirn sammelte.
"So ein kaputtes Gebiß haben wir schon lange nicht gesehen", sagte er
zur Helferin. Die aber stand nur stumm und reglos an ihrem Platz.
Nachdem er mein Gebiß erkundet hatte, richtete er sich auf und drehte
die Lampe zur Seite. Erst jetzt wurde ich gewahr, daß seine Nase
überaus groß war, ja geradezu riesig und entstellt. Hatte er einen Unfall
gehabt? Ich konnte mich nicht entsinnen, daß mir bei früheren
Behandlungen sein Äußeres derart unangenehm aufgefallen war. Doch
noch ehe ich dazu kam in meiner Erinnerung weiter zu forschen, fiel mir
die Spitze seiner Nase auf. Irgend etwas Helles schimmerte dort im
Licht.
"Da haben wir reichlich zu tun", sagte der Arzt und schreckte mich damit
aus meinen Beobachtungen auf. "Er ist für heute der letzte Patient",
erklärte die Helferin.
"Dann haben wir ja schön viel Zeit", sagte er und rieb sich seine groben
Hände. Die Helferin lachte. Ihr fehlten oben und unten Schneidezähne.
Und die anderen Zähne waren mehr gelb als weiß. Durch
Absplitterungen waren sie zudem verunstaltet. "Was für ein häßliches
Gebiß", dachte ich und war zugleich erschrocken wie enttäuscht.
Der Zahnarzt drehte die blendende Lampe zurück. Dann griff er zu
einem Bohrer und hielt ihn mir übers Gesicht. Die Helferin hielt
das Absaugröhrchen bereit. Jetzt ging es also los. Ich versuchte mich
tiefer in den Behandlungsstuhl zu drücken, als könnte ich dadurch dem
Bohrer entweichen.
"Wenn es schmerzt müssen Sie die Hand heben", sagte er.
Ich öffnete meinen Mund und sie fuhren mit ihren Instrumenten in die
Mundhöhle. Der Bohrer jaulte auf. Er pfiff und quietschte, und sogleich
schoß mir ein schauriges Gefühl durch Mark und Bein. Das Absaugrohr
röchelte, und Kühlwasser spritzte mir wie bei einem Springbrunnen aus
dem Rachen. Plötzlich befürchtete ich, daß der Bohrer in meinem Zahn
stecken bleiben würde und wollte meine Hand anheben. Aber in meinen
Glieder war kein Gefühl mehr. Sie wollten mir nicht gehorchen. Meine
Hand blieb regungslos, wie tot, auf dem Leder des Stuhls liegen. Da
nahm der Arzt den Bohrer zu meiner Erleichterung heraus. Ich
konzentrierte mich um ruhiger zu werden. Bloß nicht schlapp machen,
dachte ich. Es wird schon nicht so schlimm. Im blendenden Schein der
Lampe sah ich schemenhaft, wie er einen anderen Bohrer vorbereitete.
Ein größeres, brummendes Gerät. Und ehe ich mich versah schirmte
seine riesige Nase das Licht, und ich schaute in die häßlichen Augen des
Arztes, die wiederum ganz in meinen Rachen versanken. Den
brummenden Bohrer drückte er hart an meinen Zahn. Sofort bebte mein
ganzer Körper. Mit unüberwindbarer Kraft preßte mich etwas auf den
Stuhl. Doch was war das? An der Nasenspitze des Arztes baumelte ein
großer Tropfen, der das Licht in schillernden Farben brach. Dieser
Tropfen schwebte in drohender Lokkerheit über meinen aufgesperrten
Rachen.
"Den Mund auf, weiter, weiter, Mensch, wie soll denn da einer rein
kommen", rügte mich der Arzt. Und die Helferin hebelte mit dem
Absaugrohr an meinen Zähnen, daß ich schon fürchtete, gleich bricht mir
der Kiefer.
"Nein nicht!" wollte ich rufen, aber wie?
Der Bohrer ruckelte in meinem Zahn,
der Tropfen unter Nasenspitze wuchs
und wuchs, mein Kopf schlug gegen die
Stütze, mein Körper wurde hin- und her
geschlagen, da löste sich der riesige
Tropfen von der Nase und entsetzt
schaute ich in das lachende Gesicht
der hübschen Helferin, die mich noch
immer an der Schulter rüttelte.
"Haben Sie gut geruht?" fragte mich der
Zahnarzt und reichte mir seine Hand.
"Entschuldigen Sie das es etwas länger
gedauert hat. Aber sie haben ja die Zeit
sinnvoll genutzt."
Von meinem Traum noch ganz
benommen erwiderte ich seinen
Handschlag.
(c) Klaus Dieter Schley