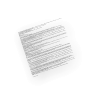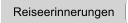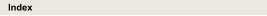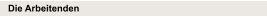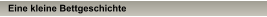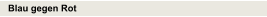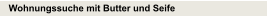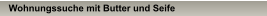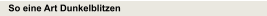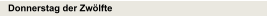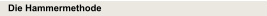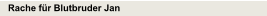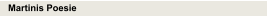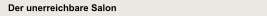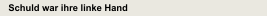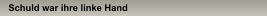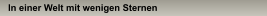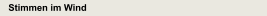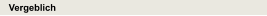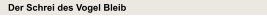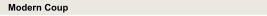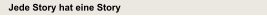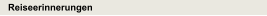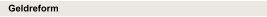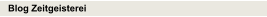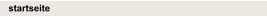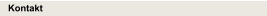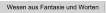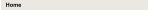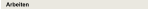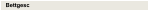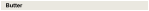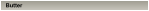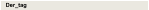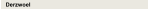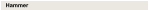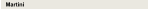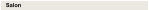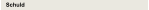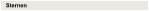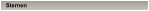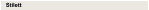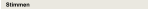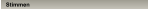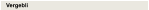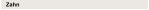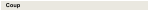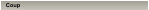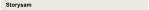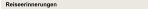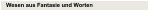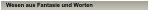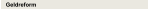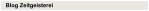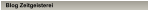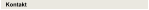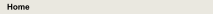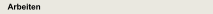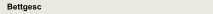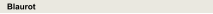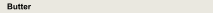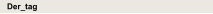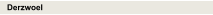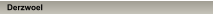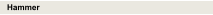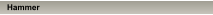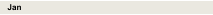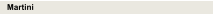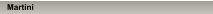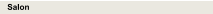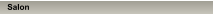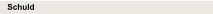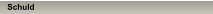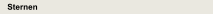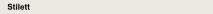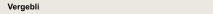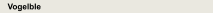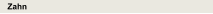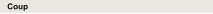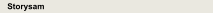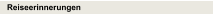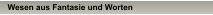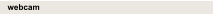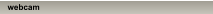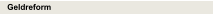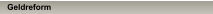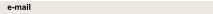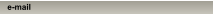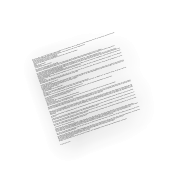


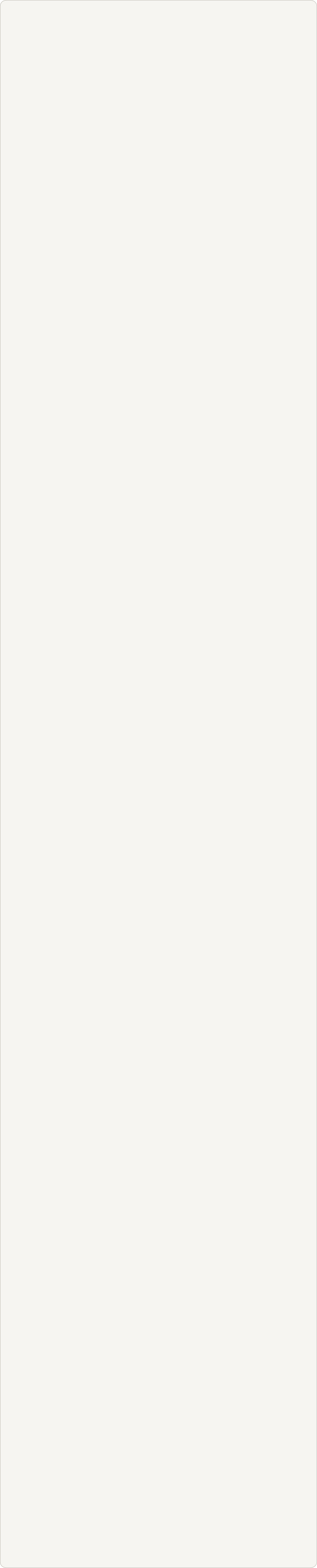
Die Stimmen im Wind
Hatte jemand gerufen?
Er lag auf dem Bett und blätterte lustlos in einer Zeitschrift, als er gegen die Balkontür aufschaute,
in die brütende Mittagshitze lauschte und nach einer Weile, in der er nur die entfernte Brandung
des Meeres hörte, wie das Gezwitscher der immer munteren Spatzen, stand er auf und ging auf
den Balkon hinaus. Sich auf die erhitzte Brüstung abstützend schaute er über die Dächer des
Dorfes zum Meer, in dessen Wellen sich das Licht der Sonne tausendfach spiegelte. Es würde
einer der heißesten Tage in diesem Jahr werden und der von Afrika wehende Wind brachte keine
Abkühlung, sondern wischte wie Ofenhitze über die Küste.
Ein Onkel seiner Wirtin war gestorben und er wusste sie in einem Bergdorf auf der Beerdigung.
Den Mann hatte er noch vor einigen Tagen gesehen, wie er trotz des hohen Alters mit seinem
knorrigen Hirtenstab durch die Gassen schlurfte und in einem Kafenion Stunde um Stunde saß,
inmitten der Gemeinschaft alter Männer. Sein Schnauzer, von imposanter Größe und exaktem
Schnitt, leuchtete makellos weiß in einem vom Leben gegerbten Gesicht und machte ihn auch auf
großer Entfernung unverwechselbar.
Nun war der Alte tot. Seine Ziegen und Schafe würden von seinen Enkeln verkauft werden und auf
dem Stuhl im Kafenion würde schon bald ein anderer sitzen. Und der Schnauzer würde nur noch
auf Fotos leuchten, die auf Dauer vergilbten.
In der engen Gasse unter dem Balkon schlenderte ein kleiner Junge mit schokoladenbraunen
Armen und kurzem pechschwarzem Haar vorbei. Er summte irgendein Lied, wobei er mit einem
Stecken über das unebene Pflaster kratzte, mal rechts ging, mal links, einen Moment auf einem
Bein hüpfte, sich drehte, dann weiterging und irgendwo hinter einer Hausecke verschwand.
Nein, er war von niemanden gerufen worden. Wer sollte auch? Er war ein Tourist, allein reisend, ein
Müßiggänger; unbekannt in dem Ort, in dem er erst seit ein paar Tagen wohnte. Es war sicher eine
Täuschung gewesen, auch wenn er durchaus spürte seinen Namen gehört zu haben. Also zog er
sich in den dunklen Schlund seines Zimmer zurück, weil in den wenigen Minuten, in denen er auf
dem Balkon gestanden war, die Sonne ihm den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte. Er setzte
sich auf das Bett, blätterte in der Zeitschrift und ließ die Gesichter von Sportlern, von Königen und
Präsidenten, von Schauspielern und Aidskranken, von Milliardären und Kriegsopfern durch seine
Hände gleiten, bis er das Heft plötzlich fallen ließ und auf das Foto irgendeiner mehr oder weniger
berühmten Persönlichkeit schaute, das vor ihm auf dem glänzenden Papier verharrte.
Mit einem Satz sprang er auf und verließ das Haus als hätte er es plötzlich eilig. Sein Weg führte
ihn durch das Dorf hinunter zum Strand. Wohin aber wollte er? Er wußte es nicht. Niemanden
begegnete er um diese Zeit. Im Dorf wie am Strand hatten die Menschen sich in den Schatten
verkrochen. Sie flohen der Sonne und dem heißen Wind. Aber er fühlte sich gut. Er schwitzte zwar,
das ihm schon bald die Kleidung durchnässt war, aber er spürte genau, das es ihm gut tat zu
laufen.
Eine Weile schlenderte er am Wasser entlang. Dabei schaute er nach schön geformten Kieseln und
las ein paar auf, von denen er glaubte, sie wären des Sammeln wert. Er warf sie aber bald darauf
ins Meer zurück, weil sie noch schroff waren und bei weitem nicht so makellos wie es zunächst
schien. In einem Jahr, in zehn Jahren oder hundert vielleicht. Plötzlich blieb er stehen, zog seine
Schuhe aus und sprang in das Wasser ohne sich zu entkleiden. Er schwamm ein Stück hinaus,
tauchte, schwamm umher und natürlich würde jemand denken, der ihn beobachtete, das er von der
Sonne irre geworden war oder schon zuviel getrunken hatte. Aber es waren ja Ferien. Für die
meisten waren Ferien und die Einheimischen hatten sich an alles gewöhnt.
Als er sich ausgetobt hatte setzte er sich auf den Kieselstrand und schaute dem Spiel der Wellen
zu. Die Sonne, die ihm im Nacken brannte, weckte ihn schon bald aus seiner Trägheit und so stand
er auf, zog sich die Schuhe an und lief auf den Hügel zu, der den Strand begrenzte. Über einen
schmalen Pfad zwischen Felsen und verdorrtem Gestrüpp stieg er den Hang hinauf, Meter um
Meter, dabei von der Sonne gepeinigt und schwitzend, und als er endlich oben war ließ er sich
erschöpft auf einen Stein im Schatten eines knorrigen Olivenbaumes sinken.
Verrückt, ich bin ja verrückt, dachte er. Was mache ich hier? Da erinnerte er sich. Jemand hatte ihn
gerufen und in Gedanken sah er den alten Mann an einem Hang oder auf einem Hügel stehen.
Aber war das nicht schon lange her? Er spürte es nun ganz genau, dieses Gefühl, das er sich an
etwas erinnerte was schon lange, sehr lange Zeit vergangen sein musste, wie er sich auch
erinnerte, daß er in seinem Apartment auf dem Bett gesessen war und in einer Zeitschrift geblättert
hatte mit den erstarrten Gesichtern einer verstorbenen Gegenwart.
Gegen den Stamm der Olive gelehnt ließ er das Gefühl gewähren, in der Zeit verloren zu sein, bis
ihm der Schweiß, der in seine Augen gesickert war, brannte und er sich über sein tun wunderte. Er
hatte wahrscheinlich die Geduld verloren auf den Abend zu warten, wenn es kühler würde und das
Leben wieder erwachte.
Nun wollte er weiter. Er hatte sich genug erholt und stieg jenseits des Strandes zur wilden Bucht
hinab. Die Sohle des Hügels erreicht begrüßte ihn das Meer mit der Gischt der zwischen den
Felsen zerspringenden Wellen. Über Steine und Felsen hangelte er sich an der Küste entlang,
während zwanzig, dreißig, fünfzig Meter über ihm der plötzlich heftiger werdende Wind in den
Felsen und an den Sträuchern zerrte.
Zunächst noch ganz munter sprang er von Stein zu Stein, hangelte sich hier und dort etwas die
Böschung hinauf um dem anbrandenden Meer auszuweichen. Dann wieder schlenderte er über
weite Strandflächen aus Sand und Kies. Immer wieder zerrte der Wind in den Tamarisken, peitschte
die Gischt über die Steine und ließ hoch über ihm in einem dichten Bambuszaun, der die Felder vor
dem Wind schützte, ein seltsames Pfeifen erklingen. Hinter einem mächtigen Küstenabbruch tat
sich die Mündung eines ausgetrockneten Flussbettes auf. Ein schmaler Pfad führte landeinwärts,
dem er folgte. Nach der ersten Biegung befand er sich in einem von der Sonne aufgeheiztem
länglichen Tal. In dem Tal war es windstill und die Hitze wurde ihm plötzlich unerträglich, so das er
erschöpft in den Schatten eines Felsen flüchtete.
Einige Augenblicke stand er gegen den Felsen gelehnt, dann ließ er sich auf einen Stein nieder.
Zunächst saß er noch etwas verkrampft, bis die Müdigkeit ihn weiter hinab sinken ließ und er sich
passend in eine Mulde kuschelte. Vom Meer war nichts zu hören, obwohl es kaum mehr als hundert
Schritte entfernt war. Nur der Wind spielte auf den unzähligen Bambusstäben des Zauns eine
geheimnisvolle Melodie.
Gegenüber seinem Lagerplatz im grellen Licht der Sonne ragte das Stück einer Säule aus dem
Hang. Es war nichts ungewöhnliches in diesem Landstrich, dessen Böden noch zahlreiche
Zeugnisse vergangener Kulturen bargen. Schon häufig war er über halb verschüttete Säulen und
Bruchstücken von Bögen gestiegen, für die sich niemand interessierte, weil es reichlich davon gab.
Wenn er sich ausgeruht haben würde, dachte er, aber dann ließ er seine Gedanken laufen, ließ
sich in einen Traum sinken. Er spürte den Stein an seiner Hüfte drücken, gegen den er lag; er
spürte, wenn der Wind Eingang in die Flussmündung gefunden hatte und mit Staub um ihn wirbelte.
Er hatte geschlafen und wieder meinte er gerufen worden zu sein. Es war ein heißer, ein nahezu
unerträglich heißer Tag, der ihm glauben machte Stimmen zu hören. Viele Stimmen, hunderte,
Tausende. Riefen sie ihn? Aber warum? Es waren Menschen, über deren Leben er manches
gelesen hatte. Nun aber wollten sie zu ihm sprechen. Sie hatten ihm etwas zu sagen, etwas
wichtiges, das alle, die jetzt lebten, wissen sollten und von dem sie glaubten, das es sich nicht
durch ihre Säulen, ihre Tonscherben, ihr Werkzeug und ihre Waffen mitteilen ließe. Er glaubte ihre
Stimmen zu hören obwohl er wusste, dass es nicht möglich war, dass es an der Hitze liegen
musste.
Die Sonne war durch hohe Mauern abgeschattet und in den Schatten bewegten sich viele
Menschen. Sie arbeiteten ohne aufzuschauen, sie nahmen ihn nicht war. Sie bearbeiten Steine,
meißelten, frästen; sie formten Ton- und Lehmmassen, sie rührten und stampften in großen
Gefäßen.
Es gelang ihm nicht ihre Gesichter zu erkennen. Manche waren abgeschattet. Anderen ließ das
grelle Licht der Sonne ihr Antlitz schmelzen. Plötzlich stand er vor einem großen Platz. Er hatte
freie Sicht über eine mächtige Stadt und zu den Bergen hinüber, deren Hänge dicht bewaldet
waren. Die Berge schienen ihm bekannt zu sein, obwohl er sich nicht erinnern konnte sie jemals so
gesehen zu haben. In den Tälern gab es Äcker auf deren erdige Böden viele Menschen arbeiteten.
Und dann das Meer: blau unter einem blauen Himmel. Auch kannte er dieses Meer.
Am Seitenrand des Platzes stand ein großes Gebäude. Neben dem Eingang lagen Tafeln mit farbig
gemalten Tieren und mit Menschen von der Art, wie sie ihm begegnet waren. Und es gab Tafeln mit
Gestalten von mystischem wie göttlichem Aussehen. Auch standen dort große bemalte Krüge,
gefüllt mit klarem Wasser, mit Getreide und mit duftenden Ölen.
Durch eine Fensterhöhlung sah er einen alten Mann im Halbdunkel des Raumes auf dem Boden
hocken. Der Alte meißelte Schriftzeichen in eine Tafel. Sein Gesicht war nicht zu erkennen, nur sein
weißer Schnauzer. Hatte der Mann ihn bemerkt? Der Alte winkte ohne von seiner Arbeit
aufzuschauen.
Durch eine schmale Tür gelangte er in einen verwinkelten dunklen Raum, in dem überall Krüge
standen neben unbemeißelten Steinplatten, Säulen und halbe Skulpturen. Ihm schien, als befände
er sich in einem Museum, in dem alles durcheinander geraten war. Von irgendwo her drangen die
Arbeitsgeräusche des Alten; auch war entfernt das Leben der Straße zu hören. Es waren Stimmen,
viele Stimmen, ein Raunen wie von belebten Gassen und Plätzen, das durch die dicken Mauern
drang. Um ihn herum aber war es ruhig und verlassen von allem Lebendigen.
Warum hatte der Alte gewunken? Wollte er etwas zeigen oder wollte er etwas verkaufen? Er spürte,
als er in seinen Hosentaschen suchte, seine Kreditkarte und gleichzeitig fiel ihm eine Schale mit
Münzen von grober Form auf. Auf einer der Münzen entdeckte er das Profil seines Kopfes. Mit
zitternden Fingern wollte er zugreifen, doch schreckte er zurück. War etwas? Er schaute sich um,
aber nirgends war jemand zu sehen. Die Krüge, die Steinplatten, alles lag bewegungslos an seinem
Platz. Und es war still geworden. Auch die Arbeitsgeräusche aus dem verborgenen Nebenraum
waren verstummt. War die Stadt, waren die Gassen plötzlich ausgestorben? Nur das Meer konnte
er in der Ferne hören. Als er wieder auf die Münzen schaute waren die Prägungen kaum noch zu
erkennen. Sie schienen verwittert, von der Zeit abgeschliffen und Staub hatte sich auf ihnen
abgesetzt. Das spärliche Licht in dem Raum hatte ihn wohl getäuscht.
Durch eine Tür, die ihm zunächst nicht aufgefallen war, gelangte er in einen anderen Raum und von
dort ging es weiter zu einem nächsten und sofort - ein Raum schloss sich einem weiteren an und
alle waren sie gefüllt mit Tausenden Scherben, zerbrochenen Alltagsgegenständen, mit Krügen,
Skulpturen und überall mit Fresken an den Wänden, die er in der Dunkelheit kaum zu erkennen
vermochte. Nur einen Ausgang schien es nicht zu geben. Doch wozu auch? Es machte ihm ja
nichts aus durch die Räume zu laufen, weil er dabei ein Gefühl hatte als erinnere er sich. Ja, es war
das Gefühl einer angenehmen, leicht wehmütigen Erinnerung das ihn Schritt für Schritt begleitete.
Der Durst machte sich jäh bemerkbar. Auch wollte er etwas essen. Nur wenig - Oliven vielleicht,
auch eine Tomate. Vor allem aber wollte er trinken: eine Karaffe mit Fruchtsaft und großen
Eiswürfeln darin. Habt ihr denn nirgends etwas zu essen und zu trinken hätte er am liebsten
gerufen, doch zog er es vor zu schweigen. Vermutlich war es besser unbemerkt zu bleiben. So
entsann er sich, dass er große Krüge mit klarem Wasser darin gesehen hatte. Doch jeder Krug, in
dem er nun schaute, war gefüllt mit einem schwarzen, alles verschlingenden Nichts.
Plötzlich entdeckte er in einer Ecke den Alten. Sofort erkannte er ihn an seinem Schnauzer und
noch immer hatte er eine Tafel vor sich stehen. Er saß da und winkte. Nein, nicht das er kommen
sollte. Er winkte ihm den Weg. War in seiner Geste etwas drohendes? Geh! geh! deutete er ihm,
geh! geh! und er lief bis er sich plötzlich im Schatten einer hohen Mauer befand, am Rande des
Platzes, von der er eine gute Sicht über die Stadt, das Meer und die Berge hatte.
Über der Stadt lag ein sanftes Gemurmel, ein pfeifender Singsang aus ungezählten Kehlen. Er sah
Kinder, alte und junge Frauen, Männer jeden Alters und Aussehen und Menschen in Rüstungen
und auf Pferden. Die auf den Pferden saßen schwenkten eifrig ihre Schilder und Sperre, wobei sie
ihre imposant geschmückten Köpfe hin und her warfen. Sie erteilten Befehle, nach denen sich alle
zu richten hatten. Und Befehle wie Befehlende gab es reichlich. Dennoch schien es, als würden die
Menschen ohne Ziel und ohne Sinn umher laufen. Auch hier war es ihm nicht möglich in die
Gesichter der Leute zu schauen, ihre Augen zu erblicken, die Form ihres Mundes und ihrer Nase zu
ergründen. Die Gesichter schienen wie verschwommen, vom Licht aufgelöst oder von irgend etwas
verdunkelt. So sehr er auch versuchte sich ein Bild von den Menschen zu machen, so wenig gelang
es ihm. Auch nahm niemand von ihm Notiz. Die Leute waren damit beschäftigt sich auf ihre Art zu
bewegen, aus irgendeiner Gasse auf dem Platz zu erscheinen, in der Masse und ihrem Singsang
einzutauchen und nach irgendwohin zu verschwinden - als hätte es sie nie gegeben.
Er war müde und setzte sich auf einen Stein.
Noch immer war der Himmel so beherrschend blau. Und die Stimmen vieler Menschen, die über
den weiten Platz zogen, vereinten sich zu einem großen Gemurmel das in ein langsam
versiegendes Rauschen überging. Als er sich umschaute sah er, dass der Schatten, in dem er sich
gesetzt hatte, schon mehr als die Hälfte der Schlucht einnahm. Für einen Augenblick viel es ihm
schwer zu begreifen wo er war, obwohl er wusste, dass er geträumt hatte, daß seine Gedanken im
Halbschlaf ihre Wege gegangen waren und er ihnen willenlos und mit einem angenehmen
neugierigen Gefühl gefolgt war. Das er sich nicht auf seinem Bett liegend wiederfand irritierte, aber
nur bis er plötzlich seine Hüftknochen spürte und sein linkes Bein, in dem es schmerzhaft kribbelte
weil es eingeschlafen war.
Er schaute hoch zum Zaun, aber der Wind hatte nachgelassen und es war still. Die Stimmen waren
verstummt. Mühsam rappelte er sich auf, schlug den Staub aus seinen Kleidern und als sich
endlich wieder sein Bein bewegen ließ, schlenderte er langsam die Schlucht aufwärts.
Über den Pfad gelangte er zu einem Fahrweg an der eine Taverne stand. Die Frau, die in dem
länglichen dunklen Raum saß und an einem blauen Jäckchen strickte, schaute überrascht auf und
musterte den Eintretenden mit Skepsis, wohl weil dessen Haare verschwitzt wie zerzaust waren
und dessen Kleidung verschmutzt war und der sich an einen Tisch setzte und ein Kaffee und ein
Glas Wasser bestellte. Doch sie erkannte in ihm einen Touristen der wahrscheinlich verrückt genug
war um in der Hitze umher zuwandern; und schon bald setzte sie sich wieder um weiter zu stricken.
Die Sonne neigt sich dem Horizont entgegen. Durch das Fenster neben dem Eingang sah er am
Hang eines Hügels einen Mann zwischen verdorrten Tomatenstauden stehen. Auf dem Weg davor
stand ein roter Chevrolet. Manchmal wehte der leichte Wind Musikfetzen von dem eingeschalteten
Radio herüber, dann wieder waren nur die Stricknadeln der Frau zu hören. Und nach einer Weile
hätte er schwören können, das man ihn gerufen hatte.
(c) Klaus Dieter Schley
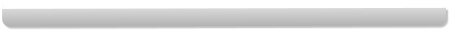
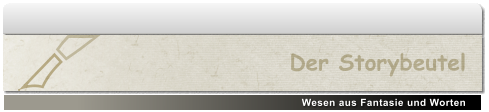
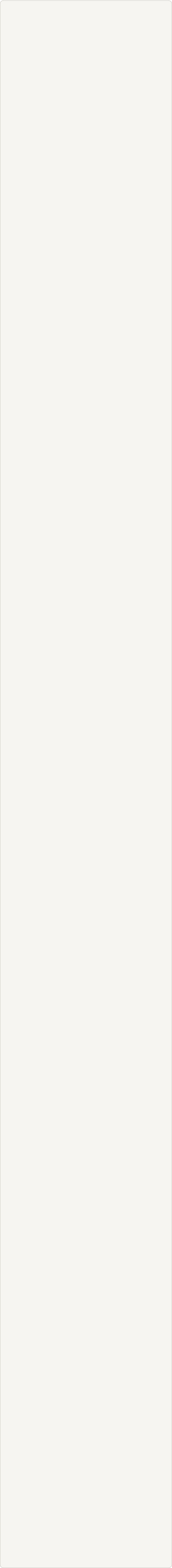
Die Stimmen im Wind
Hatte jemand gerufen?
Er lag auf dem Bett und blätterte lustlos in einer
Zeitschrift, als er gegen die Balkontür
aufschaute, in die brütende Mittagshitze
lauschte und nach einer Weile, in der er nur die
entfernte Brandung des Meeres hörte, wie das
Gezwitscher der immer munteren Spatzen,
stand er auf und ging auf den Balkon hinaus.
Sich auf die erhitzte Brüstung abstützend
schaute er über die Dächer des Dorfes zum
Meer, in dessen Wellen sich das Licht der
Sonne tausendfach spiegelte. Es würde einer
der heißesten Tage in diesem Jahr werden und
der von Afrika wehende Wind brachte keine
Abkühlung, sondern wischte wie Ofenhitze über
die Küste.
Ein Onkel seiner Wirtin war gestorben und er wusste sie in einem
Bergdorf auf der Beerdigung. Den Mann hatte er noch vor einigen Tagen
gesehen, wie er trotz des hohen Alters mit seinem knorrigen Hirtenstab
durch die Gassen schlurfte und in einem Kafenion Stunde um Stunde
saß, inmitten der Gemeinschaft alter Männer. Sein Schnauzer, von
imposanter Größe und exaktem Schnitt, leuchtete makellos weiß in
einem vom Leben gegerbten Gesicht und machte ihn auch auf großer
Entfernung unverwechselbar.
Nun war der Alte tot. Seine Ziegen und Schafe würden von seinen
Enkeln verkauft werden und auf dem Stuhl im Kafenion würde schon
bald ein anderer sitzen. Und der Schnauzer würde nur noch auf Fotos
leuchten, die auf Dauer vergilbten.
In der engen Gasse unter dem Balkon schlenderte ein kleiner Junge mit
schokoladenbraunen Armen und kurzem pechschwarzem Haar vorbei.
Er summte irgendein Lied, wobei er mit einem Stecken über das
unebene Pflaster kratzte, mal rechts ging, mal links, einen Moment auf
einem Bein hüpfte, sich drehte, dann weiterging und irgendwo hinter
einer Hausecke verschwand.
Nein, er war von niemanden gerufen worden. Wer sollte auch? Er war
ein Tourist, allein reisend, ein Müßiggänger; unbekannt in dem Ort, in
dem er erst seit ein paar Tagen wohnte. Es war sicher eine Täuschung
gewesen, auch wenn er durchaus spürte seinen Namen gehört zu
haben. Also zog er sich in den dunklen Schlund seines Zimmer zurück,
weil in den wenigen Minuten, in denen er auf dem Balkon gestanden
war, die Sonne ihm den Schweiß auf die Stirn getrieben hatte. Er setzte
sich auf das Bett, blätterte in der Zeitschrift und ließ die Gesichter von
Sportlern, von Königen und Präsidenten, von Schauspielern und
Aidskranken, von Milliardären und Kriegsopfern durch seine Hände
gleiten, bis er das Heft plötzlich fallen ließ und auf das Foto irgendeiner
mehr oder weniger berühmten Persönlichkeit schaute, das vor ihm auf
dem glänzenden Papier verharrte.
Mit einem Satz sprang er auf und verließ das Haus als hätte er es
plötzlich eilig. Sein Weg führte ihn durch das Dorf hinunter zum Strand.
Wohin aber wollte er? Er wußte es nicht. Niemanden begegnete er um
diese Zeit. Im Dorf wie am Strand hatten die Menschen sich in den
Schatten verkrochen. Sie flohen der Sonne und dem heißen Wind. Aber
er fühlte sich gut. Er schwitzte zwar, das ihm schon bald die Kleidung
durchnässt war, aber er spürte genau, das es ihm gut tat zu laufen.
Eine Weile schlenderte er am Wasser entlang. Dabei schaute er nach
schön geformten Kieseln und las ein paar auf, von denen er glaubte, sie
wären des Sammeln wert. Er warf sie aber bald darauf ins Meer zurück,
weil sie noch schroff waren und bei weitem nicht so makellos wie es
zunächst schien. In einem Jahr, in zehn Jahren oder hundert vielleicht.
Plötzlich blieb er stehen, zog seine Schuhe aus und sprang in das
Wasser ohne sich zu entkleiden. Er schwamm ein Stück hinaus, tauchte,
schwamm umher und natürlich würde jemand denken, der ihn
beobachtete, das er von der Sonne irre geworden war oder schon zuviel
getrunken hatte. Aber es waren ja Ferien. Für die meisten waren Ferien
und die Einheimischen hatten sich an alles gewöhnt.
Als er sich ausgetobt hatte setzte er sich auf den Kieselstrand und
schaute dem Spiel der Wellen zu. Die Sonne, die ihm im Nacken
brannte, weckte ihn schon bald aus seiner Trägheit und so stand er auf,
zog sich die Schuhe an und lief auf den Hügel zu, der den Strand
begrenzte. Über einen schmalen Pfad zwischen Felsen und verdorrtem
Gestrüpp stieg er den Hang hinauf, Meter um Meter, dabei von der
Sonne gepeinigt und schwitzend, und als er endlich oben war ließ er sich
erschöpft auf einen Stein im Schatten eines knorrigen Olivenbaumes
sinken.
Verrückt, ich bin ja verrückt, dachte er. Was mache ich hier? Da erinnerte
er sich. Jemand hatte ihn gerufen und in Gedanken sah er den alten
Mann an einem Hang oder auf einem Hügel stehen. Aber war das nicht
schon lange her? Er spürte es nun ganz genau, dieses Gefühl, das er
sich an etwas erinnerte was schon lange, sehr lange Zeit vergangen sein
musste, wie er sich auch erinnerte, daß er in seinem Apartment auf dem
Bett gesessen war und in einer Zeitschrift geblättert hatte mit den
erstarrten Gesichtern einer verstorbenen Gegenwart.
Gegen den Stamm der Olive gelehnt ließ er das Gefühl gewähren, in der
Zeit verloren zu sein, bis ihm der Schweiß, der in seine Augen gesickert
war, brannte und er sich über sein tun wunderte. Er hatte wahrscheinlich
die Geduld verloren auf den Abend zu warten, wenn es kühler würde und
das Leben wieder erwachte.
Nun wollte er weiter. Er hatte sich genug erholt und stieg jenseits des
Strandes zur wilden Bucht hinab. Die Sohle des Hügels erreicht
begrüßte ihn das Meer mit der Gischt der zwischen den Felsen
zerspringenden Wellen. Über Steine und Felsen hangelte er sich an der
Küste entlang, während zwanzig, dreißig, fünfzig Meter über ihm der
plötzlich heftiger werdende Wind in den Felsen und an den Sträuchern
zerrte.
Zunächst noch ganz munter sprang er von Stein zu Stein, hangelte sich
hier und dort etwas die Böschung hinauf um dem anbrandenden Meer
auszuweichen. Dann wieder schlenderte er über weite Strandflächen aus
Sand und Kies. Immer wieder zerrte der Wind in den Tamarisken,
peitschte die Gischt über die Steine und ließ hoch über ihm in einem
dichten Bambuszaun, der die Felder vor dem Wind schützte, ein
seltsames Pfeifen erklingen. Hinter einem mächtigen Küstenabbruch tat
sich die Mündung eines ausgetrockneten Flussbettes auf. Ein schmaler
Pfad führte landeinwärts, dem er folgte. Nach der ersten Biegung befand
er sich in einem von der Sonne aufgeheiztem länglichen Tal. In dem Tal
war es windstill und die Hitze wurde ihm plötzlich unerträglich, so das er
erschöpft in den Schatten eines Felsen flüchtete.
Einige Augenblicke stand er gegen den Felsen gelehnt, dann ließ er sich
auf einen Stein nieder. Zunächst saß er noch etwas verkrampft, bis die
Müdigkeit ihn weiter hinab sinken ließ und er sich passend in eine Mulde
kuschelte. Vom Meer war nichts zu hören, obwohl es kaum mehr als
hundert Schritte entfernt war. Nur der Wind spielte auf den unzähligen
Bambusstäben des Zauns eine geheimnisvolle Melodie.
Gegenüber seinem Lagerplatz im grellen Licht der Sonne ragte das
Stück einer Säule aus dem Hang. Es war nichts ungewöhnliches in
diesem Landstrich, dessen Böden noch zahlreiche Zeugnisse
vergangener Kulturen bargen. Schon häufig war er über halb
verschüttete Säulen und Bruchstücken von Bögen gestiegen, für die sich
niemand interessierte, weil es reichlich davon gab. Wenn er sich
ausgeruht haben würde, dachte er, aber dann ließ er seine Gedanken
laufen, ließ sich in einen Traum sinken. Er spürte den Stein an seiner
Hüfte drücken, gegen den er lag; er spürte, wenn der Wind Eingang in
die Flussmündung gefunden hatte und mit Staub um ihn wirbelte. Er
hatte geschlafen und wieder meinte er gerufen worden zu sein. Es war
ein heißer, ein nahezu unerträglich heißer Tag, der ihm glauben machte
Stimmen zu hören. Viele Stimmen, hunderte, Tausende. Riefen sie ihn?
Aber warum? Es waren Menschen, über deren Leben er manches
gelesen hatte. Nun aber wollten sie zu ihm sprechen. Sie hatten ihm
etwas zu sagen, etwas wichtiges, das alle, die jetzt lebten, wissen sollten
und von dem sie glaubten, das es sich nicht durch ihre Säulen, ihre
Tonscherben, ihr Werkzeug und ihre Waffen mitteilen ließe. Er glaubte
ihre Stimmen zu hören obwohl er wusste, dass es nicht möglich war,
dass es an der Hitze liegen musste.
Die Sonne war durch hohe Mauern abgeschattet und in den Schatten
bewegten sich viele Menschen. Sie arbeiteten ohne aufzuschauen, sie
nahmen ihn nicht war. Sie bearbeiten Steine, meißelten, frästen; sie
formten Ton- und Lehmmassen, sie rührten und stampften in großen
Gefäßen.
Es gelang ihm nicht ihre Gesichter zu erkennen. Manche waren
abgeschattet. Anderen ließ das grelle Licht der Sonne ihr Antlitz
schmelzen. Plötzlich stand er vor einem großen Platz. Er hatte freie Sicht
über eine mächtige Stadt und zu den Bergen hinüber, deren Hänge dicht
bewaldet waren. Die Berge schienen ihm bekannt zu sein, obwohl er
sich nicht erinnern konnte sie jemals so gesehen zu haben. In den Tälern
gab es Äcker auf deren erdige Böden viele Menschen arbeiteten. Und
dann das Meer: blau unter einem blauen Himmel. Auch kannte er dieses
Meer.
Am Seitenrand des Platzes stand ein großes Gebäude. Neben dem
Eingang lagen Tafeln mit farbig gemalten Tieren und mit Menschen von
der Art, wie sie ihm begegnet waren. Und es gab Tafeln mit Gestalten
von mystischem wie göttlichem Aussehen. Auch standen dort große
bemalte Krüge, gefüllt mit klarem Wasser, mit Getreide und mit
duftenden Ölen.
Durch eine Fensterhöhlung sah er einen alten Mann im Halbdunkel des
Raumes auf dem Boden hocken. Der Alte meißelte Schriftzeichen in eine
Tafel. Sein Gesicht war nicht zu erkennen, nur sein weißer Schnauzer.
Hatte der Mann ihn bemerkt? Der Alte winkte ohne von seiner Arbeit
aufzuschauen.
Durch eine schmale Tür gelangte er in einen verwinkelten dunklen
Raum, in dem überall Krüge standen neben unbemeißelten Steinplatten,
Säulen und halbe Skulpturen. Ihm schien, als befände er sich in einem
Museum, in dem alles durcheinander geraten war. Von irgendwo her
drangen die Arbeitsgeräusche des Alten; auch war entfernt das Leben
der Straße zu hören. Es waren Stimmen, viele Stimmen, ein Raunen wie
von belebten Gassen und Plätzen, das durch die dicken Mauern drang.
Um ihn herum aber war es ruhig und verlassen von allem Lebendigen.
Warum hatte der Alte gewunken? Wollte er etwas zeigen oder wollte er
etwas verkaufen? Er spürte, als er in seinen Hosentaschen suchte, seine
Kreditkarte und gleichzeitig fiel ihm eine Schale mit Münzen von grober
Form auf. Auf einer der Münzen entdeckte er das Profil seines Kopfes.
Mit zitternden Fingern wollte er zugreifen, doch schreckte er zurück. War
etwas? Er schaute sich um, aber nirgends war jemand zu sehen. Die
Krüge, die Steinplatten, alles lag bewegungslos an seinem Platz. Und es
war still geworden. Auch die Arbeitsgeräusche aus dem verborgenen
Nebenraum waren verstummt. War die Stadt, waren die Gassen plötzlich
ausgestorben? Nur das Meer konnte er in der Ferne hören. Als er wieder
auf die Münzen schaute waren die Prägungen kaum noch zu erkennen.
Sie schienen verwittert, von der Zeit abgeschliffen und Staub hatte sich
auf ihnen abgesetzt. Das spärliche Licht in dem Raum hatte ihn wohl
getäuscht.
Durch eine Tür, die ihm zunächst nicht aufgefallen war, gelangte er in
einen anderen Raum und von dort ging es weiter zu einem nächsten und
sofort - ein Raum schloss sich einem weiteren an und alle waren sie
gefüllt mit Tausenden Scherben, zerbrochenen Alltagsgegenständen, mit
Krügen, Skulpturen und überall mit Fresken an den Wänden, die er in
der Dunkelheit kaum zu erkennen vermochte. Nur einen Ausgang schien
es nicht zu geben. Doch wozu auch? Es machte ihm ja nichts aus durch
die Räume zu laufen, weil er dabei ein Gefühl hatte als erinnere er sich.
Ja, es war das Gefühl einer angenehmen, leicht wehmütigen Erinnerung
das ihn Schritt für Schritt begleitete.
Der Durst machte sich jäh bemerkbar. Auch wollte er etwas essen. Nur
wenig - Oliven vielleicht, auch eine Tomate. Vor allem aber wollte er
trinken: eine Karaffe mit Fruchtsaft und großen Eiswürfeln darin. Habt ihr
denn nirgends etwas zu essen und zu trinken hätte er am liebsten
gerufen, doch zog er es vor zu schweigen. Vermutlich war es besser
unbemerkt zu bleiben. So entsann er sich, dass er große Krüge mit
klarem Wasser darin gesehen hatte. Doch jeder Krug, in dem er nun
schaute, war gefüllt mit einem schwarzen, alles verschlingenden Nichts.
Plötzlich entdeckte er in einer Ecke den Alten. Sofort erkannte er ihn an
seinem Schnauzer und noch immer hatte er eine Tafel vor sich stehen.
Er saß da und winkte. Nein, nicht das er kommen sollte. Er winkte ihm
den Weg. War in seiner Geste etwas drohendes? Geh! geh! deutete er
ihm, geh! geh! und er lief bis er sich plötzlich im Schatten einer hohen
Mauer befand, am Rande des Platzes, von der er eine gute Sicht über
die Stadt, das Meer und die Berge hatte.
Über der Stadt lag ein sanftes Gemurmel, ein pfeifender Singsang aus
ungezählten Kehlen. Er sah Kinder, alte und junge Frauen, Männer jeden
Alters und Aussehen und Menschen in Rüstungen und auf Pferden. Die
auf den Pferden saßen schwenkten eifrig ihre Schilder und Sperre,
wobei sie ihre imposant geschmückten Köpfe hin und her warfen. Sie
erteilten Befehle, nach denen sich alle zu richten hatten. Und Befehle
wie Befehlende gab es reichlich. Dennoch schien es, als würden die
Menschen ohne Ziel und ohne Sinn umher laufen. Auch hier war es ihm
nicht möglich in die Gesichter der Leute zu schauen, ihre Augen zu
erblicken, die Form ihres Mundes und ihrer Nase zu ergründen. Die
Gesichter schienen wie verschwommen, vom Licht aufgelöst oder von
irgend etwas verdunkelt. So sehr er auch versuchte sich ein Bild von den
Menschen zu machen, so wenig gelang es ihm. Auch nahm niemand von
ihm Notiz. Die Leute waren damit beschäftigt sich auf ihre Art zu
bewegen, aus irgendeiner Gasse auf dem Platz zu erscheinen, in der
Masse und ihrem Singsang einzutauchen und nach irgendwohin zu
verschwinden - als hätte es sie nie gegeben.
Er war müde und setzte sich auf einen Stein.
Noch immer war der Himmel so beherrschend blau. Und die Stimmen
vieler Menschen, die über den weiten Platz zogen, vereinten sich zu
einem großen Gemurmel das in ein langsam versiegendes Rauschen
überging. Als er sich umschaute sah er, dass der Schatten, in dem er
sich gesetzt hatte, schon mehr als die Hälfte der Schlucht einnahm. Für
einen Augenblick viel es ihm schwer zu begreifen wo er war, obwohl er
wusste, dass er geträumt hatte, daß seine Gedanken im Halbschlaf ihre
Wege gegangen waren und er ihnen willenlos und mit einem
angenehmen neugierigen Gefühl gefolgt war. Das er sich nicht auf
seinem Bett liegend wiederfand irritierte, aber nur bis er plötzlich seine
Hüftknochen spürte und sein linkes Bein, in dem es schmerzhaft
kribbelte weil es eingeschlafen war.
Er schaute hoch zum Zaun, aber der Wind hatte nachgelassen und es
war still. Die Stimmen waren verstummt. Mühsam rappelte er sich auf,
schlug den Staub aus seinen Kleidern und als sich endlich wieder sein
Bein bewegen ließ, schlenderte er langsam die Schlucht aufwärts.
Über den Pfad gelangte er zu einem Fahrweg an der eine Taverne stand.
Die Frau, die in dem länglichen dunklen Raum saß und an einem blauen
Jäckchen strickte, schaute überrascht auf und musterte den
Eintretenden mit Skepsis, wohl weil dessen Haare verschwitzt wie
zerzaust waren und dessen Kleidung verschmutzt war und der sich an
einen Tisch setzte und ein Kaffee und ein Glas Wasser bestellte. Doch
sie erkannte in ihm einen Touristen der
wahrscheinlich verrückt genug war um
in der Hitze umher zuwandern; und
schon bald setzte sie sich wieder um
weiter zu stricken.
Die Sonne neigt sich dem Horizont
entgegen. Durch das Fenster neben
dem Eingang sah er am Hang eines
Hügels einen Mann zwischen
verdorrten Tomatenstauden stehen. Auf
dem Weg davor stand ein roter
Chevrolet. Manchmal wehte der leichte
Wind Musikfetzen von dem
eingeschalteten Radio herüber, dann
wieder waren nur die Stricknadeln der
Frau zu hören. Und nach einer Weile
hätte er schwören können, das man ihn
gerufen hatte.
(c) Klaus Dieter Schley