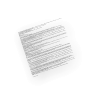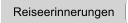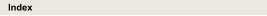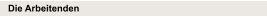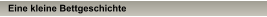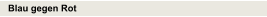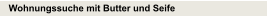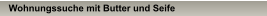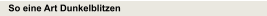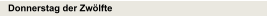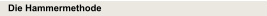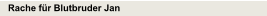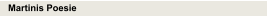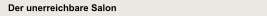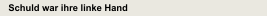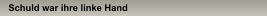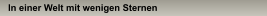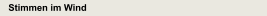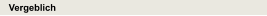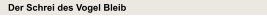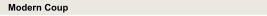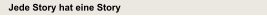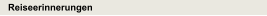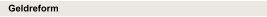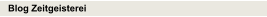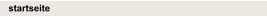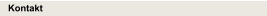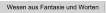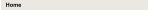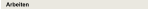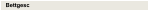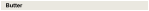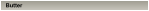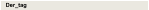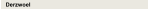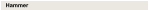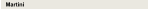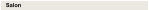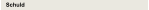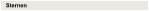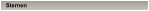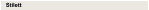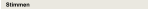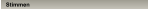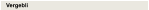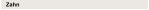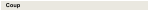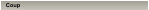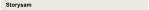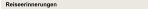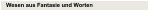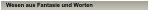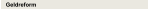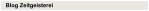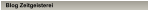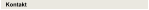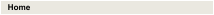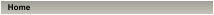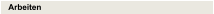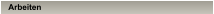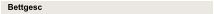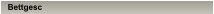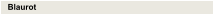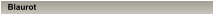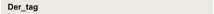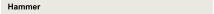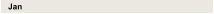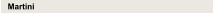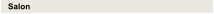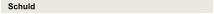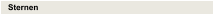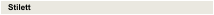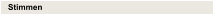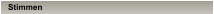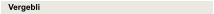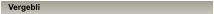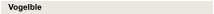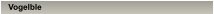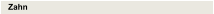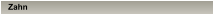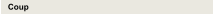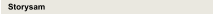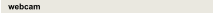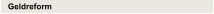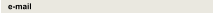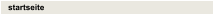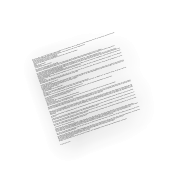


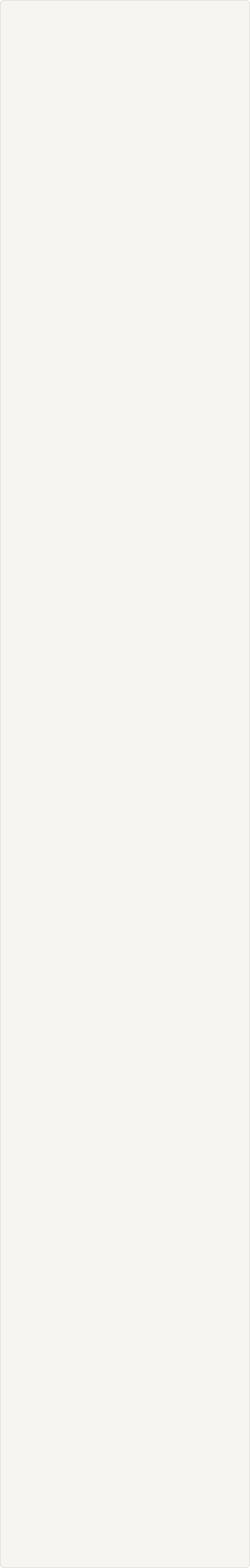
Der Schrei des Vogel Bleib
Mehrmals erwachte er in der Nacht. Sein Körper war von süßer Müdigkeit schwer, sein Geist aber
war klar und frisch. Er lag auf dem Rücken und schaute in den Himmel der sich über ihm spannte.
Die unzähligen Sterne glimmerten hell und in ihrer absoluten Ruhe waren sie von einer
faszinierenden wie banalen Schönheit.
Irgendwann waren die Sterne in einem bläulichen Grau verschwunden. Zaghaft erhob sich
Vogelgezwitscher. Er drehte sich zur Seite an den Rand der Matte. Sein Atem wischte über den
Staub und ließ Sandkörnchen tanzen. Eine Ameise durchsuchte ihre trocken Welt. Gedankenlos
schaute er ihr zu. Er spürte das Leben in seinem Körper, fühlte sich atmen, horchte auf seinen
Herzschlag und nahm den Geruch des Sandboden in sich auf.
Tief einatmend konzentrierte er sich auf einen kleinen, mit Sand bedeckten Stein. Vorsichtig blies er
die Körnchen hinunter. Die Fühler der Ameise zuckten suchend umher. Seinen Finger hielt er nun
dicht über das Insekt, bereit es zu zerquetschen. Ganz langsam senkte er den Finger, während er
dem Lauf der Ameise folgte. Wie überraschend der Tod zuschlagen konnte! Der Finger berührte die
Ameise leicht. Sie drehte sich irritiert im Kreis als er ihn etwas entfernte. Dann blieb sie stehen,
suchte mit ihren Fühlern kurz umher und eilte davon.
Er richtete sich auf und lehnte sich an den schroffen Felsen, in dessen Windschatten sein
Lagerplatz war. Über dem Gebirge und dem Meer leuchtete der Himmel immer kräftiger. Gleich
würde die Sonne hinter den zur Küste abfallenden Bergen auftauchen. Ein kühler Lufthauch spielte
um seine nackte Schulter.
Seinen Kopf hatte er zurück gelehnt. Dabei drückte sich eine scharfkantige Spitze des Felsens in
den Nacken. Langsam rieb er sich daran. Er kratzte und streichelte sich an dem rauhen Stein, der
noch die Wärme des vergangenen Tages gespeichert hatte. Dann legte er seine Hand auf den
Boden und mit gespreizten Finger fuhr er durch den seidigen, von der Nacht gekühlten Sand. Tief
zog er die milde Luft ein, dabei beobachtend, wie direkt über ihm aus den Bergen Wolken zogen.
Immer praller erstrahlten sie in knalligem Orange, während sie sich allmählich zum Meer hin
auflösten.
Aus der Bucht erhob sich plötzlich das Tuckern eines Fischkutters. Eine Melodie, die sich langsam
aus dem dunklen Massiv der Felsenküste in das offene Meer verlagerte. Dort drüben, wo der
Himmel zu brennen schien, lag Hora Sfakion. Das Licht einer Lampe hatte in der Nacht den
Sternen wie zur Antwort gefunkelt. Doch während des Tages war von dem Küstenort nichts zu
sehen.
Und da war er wieder! Hoch über ihm schwebte der Vogel. In weiten Kreisen zog er durch die klare
Luft. Plötzlich ließ er sich vom ablandigen Wind auf das Meer hinaus tragen. Der kleine Punkt verlor
sich bald am Himmel. Das war der Vogel Bleib. Oder war es doch nur eine Möwe?
Wind kam auf. Vom Meer kommend strich er kühl um den Felsen und ließ ihn frösteln. Er ruckelte
sich den Schlafsack über sein Schulter bis hoch unter die Nase. Da tauchte die Sonne dicht bei der
Küste aus dem Meer auf. Sein letzter Tag begann. Ein Tag und keine Nacht mehr; ein Tag, der
schon kein richtiger mehr war, gekennzeichnet von diesem Termin. Bleib, schrie der Vogel. Er hatte
es genau gehört. Bleib! Was hält dich davon ab?
Wie erstarrt saß er am Felsen gelehnt, beobachtend, wie sich die Sonne vom Meer löste. Als sie
eine handbreit über dem Wasser stand, dabei eine deutlich spürbare Andeutung ihrer südlichen
Kraft verkündend, rekelte er sich aus seinem Schlafsack. Nun war der seewärtige Wind angenehm
mild.
Seine Wasserflasche war noch zu einem knappen Viertel gefüllt. Genug um sich zwei Tassen
Kaffee zu kochen, nur Zähneputzen war dann nicht mehr möglich. Mit verschränkten Beinen auf
dem Schlafsack sitzend, breitete er auf einer Plastiktüte sein Besteck aus, wühlte in dieser oder
jener Tüte und entschied sich für den Kaffee. Die Zähne konnten noch warten. Die Steine des
zerfallenen, venezianischen Kastell - in dessen Nähe er lagerte - leuchteten feurig im Morgenlicht
und erhoben sich bizarr aus der Landzunge gegen den Himmel. Er blinzelte in die Sonne. Wie
schön konnten Augenblicke sein. Bleib, dachte er - immer und ewig. Aber da schwand das zarte
Glück, denn es verträgt keine Gedanken.
Den Schafskäse bröselte er auf ein Stück Weißbrot. Aus einer halben Paprika schüttelte er die
flachen Samenkörnchen, dann schnitt er die Schote in schmale Streifen. Das Wasser, in einem
zerbeulten Leichtmetalltopf über einen Gaskocher erhitzt, brodelte.
Nach dem Frühstück verstaute er das Geschirr und den zusammengerollten Schlafsack in den
Rucksack, zog seine staubgrauen Schuhe über die nackten Füße und hockte sich auf den Felsen.
Da fiel ihm die Ansichtskarte ein.
Die eleganteste Sekunde des Sprunges zeigte das Bild. Es hatte sich in seine Erinnerung
eingebrannt. Der Mann schien vor einem rauhen steilwandigen Felsen zu schweben. Seine Brust
geschwollen, den Kopf in den Nacken gelegt, das Gesicht angespannt dem Horizont zugewandt,
die Arme ausgebreitet. Wie der Sprung enden würde konnte er nur ahnen. Wahrscheinlich würde
der Mann den Kopf zwischen die Arme nehmen und senkrecht ins Meer schießen. Ob das Bild
überhaupt von dieser Insel stammte? Die Ansichtskarte hatte er an irgendeinem Kiosk neben einem
Hotel gesehen. Vor ein paar Monaten war der Vater eines Freundes in den Alpen tödlich
verunglückt. Zweihundert Meter im freien Fall. Auch daran dachte er in letzter Zeit häufig.
Von den Berghängen meckerten Ziegen die sich in den für Menschen unzugänglichen Regionen
über Nacht zurückgezogen hatten. Wenn ihm noch ein paar Tage blieben wollte er gerne noch
einmal dort oben wandern und, hunderte Meter über dem Meer, erhabene Stille genießen. Wenn er
dann auch Abends müde, ja erschlagen mit schmerzenden Gliedern zu seinem Lagerplatz
zurückkommen würde, wäre dies allemal besser als den Weg zu gehen, den er heute gehen sollte.
Bis zum späten Nachmittag mußte er in Hora Sfakion sein.
Auf dem Fels sitzend konnte er in Richtung des Kastells bis zum Lagerplatz der beiden Mädchen
schauen. Zusammengekauert lagen sie in ihren Schlafsäcken und schliefen noch. Sie hatten Zeit.
Irgendwann - von der Sonnenwärme geweckt - würden sie langsam aufstehen. Beim Frühstücken
würden sie entscheiden, ob sie noch einen Tag bleiben sollten oder schon heute mit dem
Nachmittagsboot bis nach Agia Roumeli zu fahren. Ihnen blieben noch zehn Tage. Bis in den
Oktober hinein, das hatten sie ihm unten in der Taverne bei Fisch und Wein erzählt. Die meisten
Leute nahmen das Boot um zu den Orten zu gelangen. Er aber war von Agia Roumeli zu Fuß
gekommen, eine knappe Tagestour weit. Der Weg verlief zum Teil dicht am Wasser entlang, dann
wieder hoch über den steilen Hängen und Klippen der Küste. Nirgends Schatten. Nach Hora
Sfakion war der Weg genauso, wenn auch kürzer.
Eines der Mädchen bewegte sich. Also rutschte er vom Felsen, schulterte seinen Rucksack und
ging zum Abhang, wo sich ein schmaler Weg ins Dorf hinabschlingelte. An dem Hang stehend
drehte er sich um und schaute zu seinem verlassenen Lagerplatz, einer schmalen Sandfurche
zwischen Steinen und dornigem Gestrüpp vor einem massiven Stein. Wer würde dort als nächstes
lagern? Er schaute noch einmal hinüber zum Kastell. Ein Vogel erhob sich vom Turm, stieg schnell
in die Höhe und stieß von Zeit zu Zeit diesen Schrei aus. Ja gerne, rief er dem Vogel nach. Über
den Bergen waren keine Wolken mehr. Der Himmel leuchtete dunkelblau und in der Erinnerung sah
er sie beim Kastell sitzen. Sie hatte gelacht. Das sei doch nur eine Möwe, hatte sie ihm erklärt. Ok,
mit etwas Fantasie könnte man meinen, daß diese Möwe bleib rief.
Er hatte sie an einem Nachmittag beim Kastell kennen gelernt. Sie saß im Schatten des Turmes
und laß ein Buch. Als er fragte, zeigte sie ihm den Titel. "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins."
Soeben erschienen, erklärte sie. Ihm fiel das Bild von der Ansichtskarte ein.
Bis in den Abend saßen sie beim Kastell und unterhielten sich. Sie hatte Kunst studiert und
arbeitete nun in einer Galerie. Er hatte ihr erzählt, daß er sich den ganzen Sommer in der Region,
auch in Israel herum getrieben habe. Ein Abigeschenk seiner Eltern. Zunächst mit einem Freund,
später allein. Nun mußte er nach Hause, weil er eine Lehre absolvieren müsse. Dann solle er
studieren um anschließen den Betrieb seines Vaters zu übernehmen. Ein großer Betrieb mit ein
paar hundert Beschäftigten. Ein Betrieb, der ihm alle Zeit und Freiheit nehmen würde.
Und das möchtest du nicht, hatte sie gefragt. Ich weis nicht, sagte er. Der Betrieb steht gut da. Ich
werde viel Geld haben... Ich habe nicht viel Geld, warf sie ein und deshalb habe ich auch wenig Zeit
und Freiheit, um zu tun was ich möchte. Dann lachte sie. So sei das nun einmal.
Wenn du Kunst studiert hast, sagte er nach einer Weile, mußt du das doch kennen, ich meine, das
sich einem die Wirklichkeit manchmal anders als augenscheinlich zeigt. Wieder hatte sie gelacht
und er hätte ihr am liebsten auf ihre Augen geküsst. Sind Menschen, die bis über beide Ohren
verliebt sind deswegen Künstler, fragte sie und weil er nichts sagte, sondern nur aufs Meer schaute
sagte sie, oder Menschen die voller Haß sind, sind sie deswegen Künstler? Zur Kunst gehört viel
Arbeit und Disziplin, damit deine nichtaugenscheinliche Wirklichkeit zu einem verwertbaren Material
werden kann. Sonst stürzt man ab, ergänzte er. Sie schaute ihn fragend an und er erklärte, das sei
nur so ein Gedanke. Man verliert den Boden unter den Füßen, wenn man kein Künstler ist und
einfach so herumläuft. In dieser anderen Wirklichkeit, meine ich. Ja, das kann schon sein, stimmte
sie ihm zu. Zum Abschied sagte sie noch, das er ein seltsamer Vogel sei, der ihr hier zwischen den
Steinen über dem Weg gelaufen sei. Dabei hatte sie wieder gelacht.
Und nun war die Zeit um. Fast wäre er ausgerutscht, als er sich abrupt umdrehte um den schmalen
Weg ins Dorf hinab zu steigen.
Zwischen den fensterlosen Seitenwänden zweier dicht stehender Häuser führte der Weg auf die
Mole. Ein kleines Boot mit einem tuckernden Außenbordmotor wurde soeben daran festgemacht.
Heute Abend würde es also wieder frischen Fisch geben. Er ging bis zu dem Strand und setzte sich
auf einem der Felsen, die aus dem Kiesel herausragten. Die Sonne hatte ihre pralle Röte verloren
und weckte nun mit gleißendem Licht das Dorf. Aus eine der Tavernen klapperten Tische und
Stühle, ein Mann fegte den holprigen Betonboden einer Terrasse, irgendwo kreischte ein Kind. Von
schwacher Müdigkeit umfangen betrachtete er das Dorf, schaute hin und wieder zu dem blauen,
fensterlosen Holztürchen des winzigen Geschäftes. Als die Tür von innen geöffnet wurden, erhob er
sich, nahm seinen Rucksack und schlenderte an dem Kieselstrand entlang bis er in gleicher Höhe
des Gebäudes war. Dann ging er direkt auf den Laden zu, stellte den Rucksack neben die Tür und
betrat das Geschäft.
Eine junge Frau zählte Geld und ein kleiner Junge hüpfte in dem Laden umher. Beide nahmen sein
Eintreten mit einem flüchtigen Seitenblick war. Nur wenige Waren standen zur Auswahl: etwas Obst
und Gemüse, ansonsten Konservendosen, Sonnenöle und Ansichtskarten. Über allem lag eine
dünne Schicht Staub, die pelzig im Licht schimmerte. Er kaufte sich eine Flasche Wasser und zwei
Äpfel. Zu seiner Überraschung stammte die Inhaberin des Ladens aus Tirol. Sie hatte in dem Dorf
ein kleines Auskommen gefunden. Die Frau wünschte ihm eine gute Heimreise.
Vor dem Laden schnürte er die Wasserflasche an seinen Rucksack und verstaute die Äpfel. In
östliche Richtung verließ er das Dorf, wanderte über einen kleinen Hügel und gelangte nach einer
halben Stunde zur anderen Seite der Bucht. Friedlich und sein Fortgehen nicht wahrnehmend lag
das Dorf im Sonnenlicht vor dem glitzernden Wasser. Er wischte sich den Schweiß von der Stirn
und beobachtete Touristen, die am Ufer promenierten. Einige ließen sich langsam in den Tavernen
zum Frühstück nieder.
Bis zu dem Sandstrand unter hohen Felsen war der Weg nicht besonders schwierig und gut zu
laufen. Er führte dicht an der Küste entlang, mal direkt am Wasser, dann wieder hoch über dem
Meer. Am Strand entschied er sich, ein paar Stunden zu bleiben. Noch hatte er Zeit und wollte die
Gelegenheit nutzen, um noch einmal zu baden. In den Felsen befanden sich kleine Höhlen, die von
Rucksacktouristen zum Quartier genommen waren. Langsam krochen sie aus ihren Schlafsäcken,
bereiteten sich etwas zu essen, putzten mit dem Wasser aus der Süßwasserquelle ihre Zähne oder
sprangen in das Meer um zu plantschen.
Er zog sich aus und legte sich auf seine Strohmatte. Die Wanderung mit dem schweren Rucksack
so früh in der Hitze hatte ihn schon etwas ermüdet und so döste er, halb schlafend, halb wachend,
dabei die brennenden Strahlen der Sonne auf seinem Körper spürend - wie eine sanfte Massage.
Er lauschte dem leisen plätschern der Wellen und er hörte Leute an sich vorbeiwandern; er hörte
ihre Stimmen, die sich mit denen der Strandbewohner mischten, er hörte wie sich Leute in seiner
Nähe niederließen, ihre Sachen auspackten, sich entkleideten und mit Sonnenöl einrieben; er
blinzelte einen Moment zu ihnen hinüber und sah nackte, gebräunte Körper in der Sonne glänzen,
dann döste er wieder ein, wurde wach, schlief ein und wachte plötzlich schweißgebadet auf. Nur
langsam kam er zu Bewußtsein wo er war. Er richtete sich auf und es wurde ihm schwarz vor den
Augen. Er mußte aufpassen nicht zu lange in der prallen Sonne zu liegen.
Nachdem sich sein Kreislauf beruhigt hatte, stand er auf und streckte sich. Die Sonne prallte fast
steil vom Himmel, wenn auch der Horizont in grauem Dunst versank. Es war windstill, die Luft stand
in ihrem eigenen Glast. Er schlenderte bis zum Wasser, ließ seine Füße von den sanft
auslaufenden Wellen umspülen und watete dann soweit ins Meer, das er schwimmen konnte. Dann
drehte er sich auf den Rücken und ließ sich treiben. Die Leichtigkeit aber fehlte, mit der er sich in
den vergangenen Wochen vom Meer hatte tragen lassen. Seine Schwimmzüge kamen ihm
verkrampft vor, wie ein lustlos vollzogenes Ritual. Also schwamm er an das Ufer zurück und setzte
sich an den Strand. Am südwestlichen Horizont tauchte ein Frachtschiff auf, das kaum sichtbar im
fernen Dunst bedächtig ostwärts zog. Nachdem die Sonne seinen Körper getrocknet hatte aß er die
Äpfel. Ihr Saft spritzte ihm ins Gesicht und tropfte ihm aus dem Mundwinkel auf den Bauch und die
Oberschenkel, um sich dort mit dem Salz auf seiner Haut zu vermischen. Mit seinem Handtuch
wischte er sich die klebrige Mischung vom Körper. Das war es dann wohl, murmelte er, zog sich an
und setzte seine Wanderung fort.
Am Ende des Strandes deuteten hin und wieder rote Farbmakierungen auf den Steinen den
weiteren Verlauf des Weges an. Das Meer war plötzlich unruhig geworden. Wellen schlugen gegen
die Steine und manchmal spritzte ihm Wasser ins Gesicht. Er mußte sich mühsam zwischen den
massiven Felsen hindurch zwängen. An einer Stelle drängte sich der Steilhang soweit an das
Wasser heran, das er sich, eine ruhige Phase der Brandung abwartend, nur mit Mühe trockenen
Fußes und ohne zu stürzen, an der Wand entlang hangeln konnte. Er wuchtete seinen Rucksack
nach, das er besser saß und setzte seinen Weg fort. Nach etlichen Metern des Balancierens über
grobe Steine in der Gischt der immer heftiger anbrandenden Wellen, wiesen die Farbmakierungen
zu einem Rinnsal, der den Anfang des Weges die Wand hinauf makierte.
Kaum das er der feuchten, dabei kühlenden Nähe des Wassers entstiegen war, spürte er die volle
Kraft der Sonne. Seine Kleidungsstücke waren schnell schweißdurchnässt. Der Pfad verlief
teilweise so steil, das er sich in einer vornübergebeugten Haltung den Hang hinauf mühte, wobei er
- ohne sich sonderlich zu bücken - den Weg vor sich berühren konnte. Polternd stürzten einzelne,
losgetretene Steine in die Tiefe. Das Brausen der Brandung verlor zunehmend an Kraft je höher er
kam.
Obgleich ihm der Schweiß aus allen Poren strömte und es immer weiter hinaufging, immer höher
ohne ein Ende nehmen zu wollen, stieg er Schritt um Schritt ohne zu ermüden. Er fühlte sich wie
hinaufgetragen. Sein Körper hatte sich an die Wanderungen unter heißer Sonne gewöhnt.
Hinter einem besonders steilen Abschnitt verlief der Weg plötzlich eben. Auch war er viel breiter als
zuvor. Ein gute Stelle um eine kleine Pause einzulegen und auch um die Aussicht zu genießen. Mit
einem Schwenke ließ er den Rucksack auf den Boden gleiten und plazierte ihn an der Felswand,
die vom Pfad aufsteigend bis in den Himmel zu reichen schien. Er setzte die Wasserflasche an und
mit ein paar kräftigen Zügen leerte er sie zu einem Drittel. Sogleich schoß aus seinem Körper der
Schweiß. An den Felsen entlang säuselnder Wind kühlte, so das er für einen Augenblick sogar
fröstelte.
Der Himmel im Westen schien von der Sonne fast gefüllt. Weit draußen am Horizont konnte er
noch eben das Frachtschiff im fahlen Dunst eintauchen sehen. Verlassen lag das Meer nun zu
seinen Füßen - wie die Ewigkeit. Zum Horizont hin war das Wasser blau und tausendfach spiegelte
sich das Sonnenlicht in kleinen, silbern blitzenden Kämmen. Mehr zur Küste hin nahm das Wasser
verschiedene Farben an: blau, grau, an manchen Stellen smaragdfarbend. Und überall waren
schwarze Flecken zu sehen. Sie stammten von Felsen, die bis dicht unter die Wasseroberfläche
ragten. Wo sie aus dem Wasser schauten, schäumte das Meer. Vor seinen Füßen tief unten schlug
die Brandung wütend an die Felsküste zwischen all' den losgebrochenen Steinen, die sich noch
scharfkantig behaupteten.
Sein Atem war ruhiger geworden. Er stellte die Wasserflasche neben den Rucksack und schabte
mit den Füßen über den Weg. Ein paar Kiesel rollten den Pfad hinab und verloren sich irgendwo im
Geröll. Dann brach er einen größeren Stein aus dem Weg und drängte ihn an den Rand des
Abhanges. Doch bevor er ihn postiert hatte, rollte der Stein langsam - wie von einer
geheimnisvollen Kraft getrieben - zur Felswand und dann einige Meter den Weg zurück. Er schaute
dem Stein nach, wie einem Tier, das sich verflüchtete, als fürchtete es die Tiefe. Ein paar hundert
Meter vor ihm erhob sich ein Vogel aus den Felsen und zog im Gleitflug dicht über der
schäumenden Brandung die Küste entlang, bis er nahe an ihn herangekommen war. Dann
schwenkte der Vogel auf das offene Meer hinaus, flog dem Horizont entgegen bis nur noch ein
kleiner Punkte zu erkennen war, der sich in einem weiten Bogen der Küste wieder näherte und der -
vom Aufwind getragen - irgendwo an der Felswand landete.
Er bückte sich und zerrte mit beiden Händen einen handtellergroßen Stein aus der brüchigen
Felswand. Ruhig, als wäre es ein Kunstwerk, beschaute er sich das Bruchstück von allen Seiten.
Die Oberfläche war porig, aber sonst war der Stein hart. Wieviel Leben sich wohl in den winzigen
Schlünden, Ritzen und Höhlungen verbarg? Mikroskopisch winziges Leben, für das dieser Stein so
groß war wie für ihn die Felsenküste. Er hohlte aus und warf den Stein in einem weiten Bogen über
den Abgrund. Dabei erinnerte er sich der Postkarte, während der Stein sich schnell drehend der
Brandung entgegen stürzte. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierund... - lautlos
gegen das Dröhnen der Brandung zersplitterte der Stein auf einem stumpf aus dem Meer ragenden
Felsen und einen Moment tänzelten seine Splitter in der Luft, bevor sie in das Meer eintauchten.
Drei Sekunden, gut drei Sekunden, dachte er, so tief ist es hier! Er stellte sich eine Zahlenreihe vor.
Vom Minus in den Plusbereich. Nicht weit ins Plus: nur drei, vier Stellen, das würde reichen, bis
dahin, dann würde es aus sein. Er schloß die Augen und zählte, konzentriert auf jeden Moment,
dann spürte er einen Windzug vom Meer heraufkommend, das Gedächtnisbild der Küste verblaßte,
machte Platz für eine wage Erinnerung. Plötzlich dieser Schrei. Er öffnete die Augen und starrte in
den Himmel. Hoch über ihm kreiste ein Vogel. Er schaute ihm nach, mit seinem Blick folgte er der
Möwe aufs Meer, von wo sie nochmals rief. Ja, ich bleib; keine Sorge, rief er ihr verhalten nach, trat
vom Abhang zurück und lehnte sich erschöpft gegen die Felswand. Vor seinen Augen flimmerten
schwarze Flecken und kalter Schweiß bildete sich ihm auf der Stirn.
Langsam erholte er sich. Der Schweiß juckte und fahrig wischte er ihn ab. Dann zog er sich seinen
Rucksack auf den Rücken und stieg den Weg weiter hinauf. Nun spürte er wie ausgelaugt er war.
Der Weg wurde flacher und bald schon konnte er die Straße sehen. Aus der Ferne hörte er einen
Bus mit gequältem Motor nahen. Jetzt war es nicht mehr weit bis nach Hora Sfakion.
(c) Klaus Dieter Schley
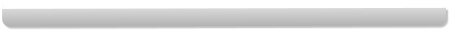
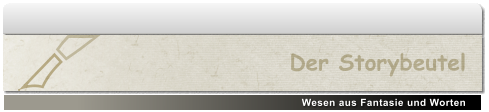
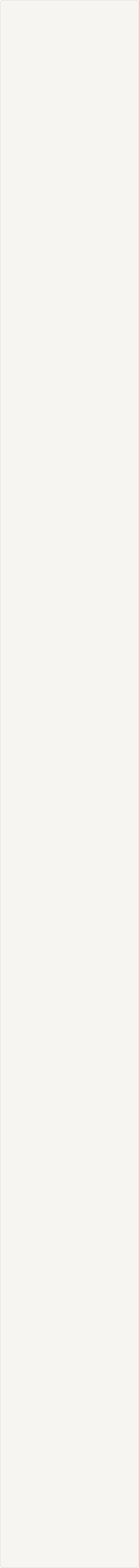
Der Schrei des Vogel Bleib
Mehrmals erwachte er in der Nacht. Sein Körper
war von süßer Müdigkeit schwer, sein Geist aber
war klar und frisch. Er lag auf dem Rücken und
schaute in den Himmel der sich über ihm
spannte. Die unzähligen Sterne glimmerten hell
und in ihrer absoluten Ruhe waren sie von einer
faszinierenden wie banalen Schönheit.
Irgendwann waren die Sterne in einem
bläulichen Grau verschwunden. Zaghaft erhob
sich Vogelgezwitscher. Er drehte sich zur Seite
an den Rand der Matte. Sein Atem wischte über
den Staub und ließ Sandkörnchen tanzen. Eine
Ameise durchsuchte ihre trocken Welt.
Gedankenlos schaute er ihr zu. Er spürte das
Leben in seinem Körper, fühlte sich atmen,
horchte auf seinen Herzschlag und nahm den Geruch des Sandboden in
sich auf.
Tief einatmend konzentrierte er sich auf einen kleinen, mit Sand
bedeckten Stein. Vorsichtig blies er die Körnchen hinunter. Die Fühler der
Ameise zuckten suchend umher. Seinen Finger hielt er nun dicht über
das Insekt, bereit es zu zerquetschen. Ganz langsam senkte er den
Finger, während er dem Lauf der Ameise folgte. Wie überraschend der
Tod zuschlagen konnte! Der Finger berührte die Ameise leicht. Sie drehte
sich irritiert im Kreis als er ihn etwas entfernte. Dann blieb sie stehen,
suchte mit ihren Fühlern kurz umher und eilte davon.
Er richtete sich auf und lehnte sich an den schroffen Felsen, in dessen
Windschatten sein Lagerplatz war. Über dem Gebirge und dem Meer
leuchtete der Himmel immer kräftiger. Gleich würde die Sonne hinter den
zur Küste abfallenden Bergen auftauchen. Ein kühler Lufthauch spielte
um seine nackte Schulter.
Seinen Kopf hatte er zurück gelehnt. Dabei drückte sich eine
scharfkantige Spitze des Felsens in den Nacken. Langsam rieb er sich
daran. Er kratzte und streichelte sich an dem rauhen Stein, der noch die
Wärme des vergangenen Tages gespeichert hatte. Dann legte er seine
Hand auf den Boden und mit gespreizten Finger fuhr er durch den
seidigen, von der Nacht gekühlten Sand. Tief zog er die milde Luft ein,
dabei beobachtend, wie direkt über ihm aus den Bergen Wolken zogen.
Immer praller erstrahlten sie in knalligem Orange, während sie sich
allmählich zum Meer hin auflösten.
Aus der Bucht erhob sich plötzlich das Tuckern eines Fischkutters. Eine
Melodie, die sich langsam aus dem dunklen Massiv der Felsenküste in
das offene Meer verlagerte. Dort drüben, wo der Himmel zu brennen
schien, lag Hora Sfakion. Das Licht einer Lampe hatte in der Nacht den
Sternen wie zur Antwort gefunkelt. Doch während des Tages war von
dem Küstenort nichts zu sehen.
Und da war er wieder! Hoch über ihm schwebte der Vogel. In weiten
Kreisen zog er durch die klare Luft. Plötzlich ließ er sich vom ablandigen
Wind auf das Meer hinaus tragen. Der kleine Punkt verlor sich bald am
Himmel. Das war der Vogel Bleib. Oder war es doch nur eine Möwe?
Wind kam auf. Vom Meer kommend strich er kühl um den Felsen und ließ
ihn frösteln. Er ruckelte sich den Schlafsack über sein Schulter bis hoch
unter die Nase. Da tauchte die Sonne dicht bei der Küste aus dem Meer
auf. Sein letzter Tag begann. Ein Tag und keine Nacht mehr; ein Tag, der
schon kein richtiger mehr war, gekennzeichnet von diesem Termin. Bleib,
schrie der Vogel. Er hatte es genau gehört. Bleib! Was hält dich davon
ab?
Wie erstarrt saß er am Felsen gelehnt, beobachtend, wie sich die Sonne
vom Meer löste. Als sie eine handbreit über dem Wasser stand, dabei
eine deutlich spürbare Andeutung ihrer südlichen Kraft verkündend,
rekelte er sich aus seinem Schlafsack. Nun war der seewärtige Wind
angenehm mild.
Seine Wasserflasche war noch zu einem knappen Viertel gefüllt. Genug
um sich zwei Tassen Kaffee zu kochen, nur Zähneputzen war dann nicht
mehr möglich. Mit verschränkten Beinen auf dem Schlafsack sitzend,
breitete er auf einer Plastiktüte sein Besteck aus, wühlte in dieser oder
jener Tüte und entschied sich für den Kaffee. Die Zähne konnten noch
warten. Die Steine des zerfallenen, venezianischen Kastell - in dessen
Nähe er lagerte - leuchteten feurig im Morgenlicht und erhoben sich
bizarr aus der Landzunge gegen den Himmel. Er blinzelte in die Sonne.
Wie schön konnten Augenblicke sein. Bleib, dachte er - immer und ewig.
Aber da schwand das zarte Glück, denn es verträgt keine Gedanken.
Den Schafskäse bröselte er auf ein Stück Weißbrot. Aus einer halben
Paprika schüttelte er die flachen Samenkörnchen, dann schnitt er die
Schote in schmale Streifen. Das Wasser, in einem zerbeulten
Leichtmetalltopf über einen Gaskocher erhitzt, brodelte.
Nach dem Frühstück verstaute er das Geschirr und den
zusammengerollten Schlafsack in den Rucksack, zog seine staubgrauen
Schuhe über die nackten Füße und hockte sich auf den Felsen. Da fiel
ihm die Ansichtskarte ein.
Die eleganteste Sekunde des Sprunges zeigte das Bild. Es hatte sich in
seine Erinnerung eingebrannt. Der Mann schien vor einem rauhen
steilwandigen Felsen zu schweben. Seine Brust geschwollen, den Kopf in
den Nacken gelegt, das Gesicht angespannt dem Horizont zugewandt,
die Arme ausgebreitet. Wie der Sprung enden würde konnte er nur
ahnen. Wahrscheinlich würde der Mann den Kopf zwischen die Arme
nehmen und senkrecht ins Meer schießen. Ob das Bild überhaupt von
dieser Insel stammte? Die Ansichtskarte hatte er an irgendeinem Kiosk
neben einem Hotel gesehen. Vor ein paar Monaten war der Vater eines
Freundes in den Alpen tödlich verunglückt. Zweihundert Meter im freien
Fall. Auch daran dachte er in letzter Zeit häufig.
Von den Berghängen meckerten Ziegen die sich in den für Menschen
unzugänglichen Regionen über Nacht zurückgezogen hatten. Wenn ihm
noch ein paar Tage blieben wollte er gerne noch einmal dort oben
wandern und, hunderte Meter über dem Meer, erhabene Stille genießen.
Wenn er dann auch Abends müde, ja erschlagen mit schmerzenden
Gliedern zu seinem Lagerplatz zurückkommen würde, wäre dies allemal
besser als den Weg zu gehen, den er heute gehen sollte. Bis zum späten
Nachmittag mußte er in Hora Sfakion sein.
Auf dem Fels sitzend konnte er in Richtung des Kastells bis zum
Lagerplatz der beiden Mädchen schauen. Zusammengekauert lagen sie
in ihren Schlafsäcken und schliefen noch. Sie hatten Zeit. Irgendwann -
von der Sonnenwärme geweckt - würden sie langsam aufstehen. Beim
Frühstücken würden sie entscheiden, ob sie noch einen Tag bleiben
sollten oder schon heute mit dem Nachmittagsboot bis nach Agia
Roumeli zu fahren. Ihnen blieben noch zehn Tage. Bis in den Oktober
hinein, das hatten sie ihm unten in der Taverne bei Fisch und Wein
erzählt. Die meisten Leute nahmen das Boot um zu den Orten zu
gelangen. Er aber war von Agia Roumeli zu Fuß gekommen, eine knappe
Tagestour weit. Der Weg verlief zum Teil dicht am Wasser entlang, dann
wieder hoch über den steilen Hängen und Klippen der Küste. Nirgends
Schatten. Nach Hora Sfakion war der Weg genauso, wenn auch kürzer.
Eines der Mädchen bewegte sich. Also rutschte er vom Felsen, schulterte
seinen Rucksack und ging zum Abhang, wo sich ein schmaler Weg ins
Dorf hinabschlingelte. An dem Hang stehend drehte er sich um und
schaute zu seinem verlassenen Lagerplatz, einer schmalen Sandfurche
zwischen Steinen und dornigem Gestrüpp vor einem massiven Stein.
Wer würde dort als nächstes lagern? Er schaute noch einmal hinüber
zum Kastell. Ein Vogel erhob sich vom Turm, stieg schnell in die Höhe
und stieß von Zeit zu Zeit diesen Schrei aus. Ja gerne, rief er dem Vogel
nach. Über den Bergen waren keine Wolken mehr. Der Himmel leuchtete
dunkelblau und in der Erinnerung sah er sie beim Kastell sitzen. Sie hatte
gelacht. Das sei doch nur eine Möwe, hatte sie ihm erklärt. Ok, mit etwas
Fantasie könnte man meinen, daß diese Möwe bleib rief.
Er hatte sie an einem Nachmittag beim Kastell kennen gelernt. Sie saß
im Schatten des Turmes und laß ein Buch. Als er fragte, zeigte sie ihm
den Titel. "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins." Soeben erschienen,
erklärte sie. Ihm fiel das Bild von der Ansichtskarte ein.
Bis in den Abend saßen sie beim Kastell und unterhielten sich. Sie hatte
Kunst studiert und arbeitete nun in einer Galerie. Er hatte ihr erzählt, daß
er sich den ganzen Sommer in der Region, auch in Israel herum
getrieben habe. Ein Abigeschenk seiner Eltern. Zunächst mit einem
Freund, später allein. Nun mußte er nach Hause, weil er eine Lehre
absolvieren müsse. Dann solle er studieren um anschließen den Betrieb
seines Vaters zu übernehmen. Ein großer Betrieb mit ein paar hundert
Beschäftigten. Ein Betrieb, der ihm alle Zeit und Freiheit nehmen würde.
Und das möchtest du nicht, hatte sie gefragt. Ich weis nicht, sagte er. Der
Betrieb steht gut da. Ich werde viel Geld haben... Ich habe nicht viel Geld,
warf sie ein und deshalb habe ich auch wenig Zeit und Freiheit, um zu
tun was ich möchte. Dann lachte sie. So sei das nun einmal.
Wenn du Kunst studiert hast, sagte er nach einer Weile, mußt du das
doch kennen, ich meine, das sich einem die Wirklichkeit manchmal
anders als augenscheinlich zeigt. Wieder hatte sie gelacht und er hätte
ihr am liebsten auf ihre Augen geküsst. Sind Menschen, die bis über
beide Ohren verliebt sind deswegen Künstler, fragte sie und weil er nichts
sagte, sondern nur aufs Meer schaute sagte sie, oder Menschen die
voller Haß sind, sind sie deswegen Künstler? Zur Kunst gehört viel Arbeit
und Disziplin, damit deine nichtaugenscheinliche Wirklichkeit zu einem
verwertbaren Material werden kann. Sonst stürzt man ab, ergänzte er.
Sie schaute ihn fragend an und er erklärte, das sei nur so ein Gedanke.
Man verliert den Boden unter den Füßen, wenn man kein Künstler ist und
einfach so herumläuft. In dieser anderen Wirklichkeit, meine ich. Ja, das
kann schon sein, stimmte sie ihm zu. Zum Abschied sagte sie noch, das
er ein seltsamer Vogel sei, der ihr hier zwischen den Steinen über dem
Weg gelaufen sei. Dabei hatte sie wieder gelacht.
Und nun war die Zeit um. Fast wäre er ausgerutscht, als er sich abrupt
umdrehte um den schmalen Weg ins Dorf hinab zu steigen.
Zwischen den fensterlosen Seitenwänden zweier dicht stehender Häuser
führte der Weg auf die Mole. Ein kleines Boot mit einem tuckernden
Außenbordmotor wurde soeben daran festgemacht. Heute Abend würde
es also wieder frischen Fisch geben. Er ging bis zu dem Strand und
setzte sich auf einem der Felsen, die aus dem Kiesel herausragten. Die
Sonne hatte ihre pralle Röte verloren und weckte nun mit gleißendem
Licht das Dorf. Aus eine der Tavernen klapperten Tische und Stühle, ein
Mann fegte den holprigen Betonboden einer Terrasse, irgendwo kreischte
ein Kind. Von schwacher Müdigkeit umfangen betrachtete er das Dorf,
schaute hin und wieder zu dem blauen, fensterlosen Holztürchen des
winzigen Geschäftes. Als die Tür von innen geöffnet wurden, erhob er
sich, nahm seinen Rucksack und schlenderte an dem Kieselstrand
entlang bis er in gleicher Höhe des Gebäudes war. Dann ging er direkt
auf den Laden zu, stellte den Rucksack neben die Tür und betrat das
Geschäft.
Eine junge Frau zählte Geld und ein kleiner Junge hüpfte in dem Laden
umher. Beide nahmen sein Eintreten mit einem flüchtigen Seitenblick war.
Nur wenige Waren standen zur Auswahl: etwas Obst und Gemüse,
ansonsten Konservendosen, Sonnenöle und Ansichtskarten. Über allem
lag eine dünne Schicht Staub, die pelzig im Licht schimmerte. Er kaufte
sich eine Flasche Wasser und zwei Äpfel. Zu seiner Überraschung
stammte die Inhaberin des Ladens aus Tirol. Sie hatte in dem Dorf ein
kleines Auskommen gefunden. Die Frau wünschte ihm eine gute
Heimreise.
Vor dem Laden schnürte er die Wasserflasche an seinen Rucksack und
verstaute die Äpfel. In östliche Richtung verließ er das Dorf, wanderte
über einen kleinen Hügel und gelangte nach einer halben Stunde zur
anderen Seite der Bucht. Friedlich und sein Fortgehen nicht
wahrnehmend lag das Dorf im Sonnenlicht vor dem glitzernden Wasser.
Er wischte sich den Schweiß von der Stirn und beobachtete Touristen, die
am Ufer promenierten. Einige ließen sich langsam in den Tavernen zum
Frühstück nieder.
Bis zu dem Sandstrand unter hohen Felsen war der Weg nicht besonders
schwierig und gut zu laufen. Er führte dicht an der Küste entlang, mal
direkt am Wasser, dann wieder hoch über dem Meer. Am Strand
entschied er sich, ein paar Stunden zu bleiben. Noch hatte er Zeit und
wollte die Gelegenheit nutzen, um noch einmal zu baden. In den Felsen
befanden sich kleine Höhlen, die von Rucksacktouristen zum Quartier
genommen waren. Langsam krochen sie aus ihren Schlafsäcken,
bereiteten sich etwas zu essen, putzten mit dem Wasser aus der
Süßwasserquelle ihre Zähne oder sprangen in das Meer um zu
plantschen.
Er zog sich aus und legte sich auf seine Strohmatte. Die Wanderung mit
dem schweren Rucksack so früh in der Hitze hatte ihn schon etwas
ermüdet und so döste er, halb schlafend, halb wachend, dabei die
brennenden Strahlen der Sonne auf seinem Körper spürend - wie eine
sanfte Massage. Er lauschte dem leisen plätschern der Wellen und er
hörte Leute an sich vorbeiwandern; er hörte ihre Stimmen, die sich mit
denen der Strandbewohner mischten, er hörte wie sich Leute in seiner
Nähe niederließen, ihre Sachen auspackten, sich entkleideten und mit
Sonnenöl einrieben; er blinzelte einen Moment zu ihnen hinüber und sah
nackte, gebräunte Körper in der Sonne glänzen, dann döste er wieder
ein, wurde wach, schlief ein und wachte plötzlich schweißgebadet auf.
Nur langsam kam er zu Bewußtsein wo er war. Er richtete sich auf und es
wurde ihm schwarz vor den Augen. Er mußte aufpassen nicht zu lange in
der prallen Sonne zu liegen.
Nachdem sich sein Kreislauf beruhigt hatte, stand er auf und streckte
sich. Die Sonne prallte fast steil vom Himmel, wenn auch der Horizont in
grauem Dunst versank. Es war windstill, die Luft stand in ihrem eigenen
Glast. Er schlenderte bis zum Wasser, ließ seine Füße von den sanft
auslaufenden Wellen umspülen und watete dann soweit ins Meer, das er
schwimmen konnte. Dann drehte er sich auf den Rücken und ließ sich
treiben. Die Leichtigkeit aber fehlte, mit der er sich in den vergangenen
Wochen vom Meer hatte tragen lassen. Seine Schwimmzüge kamen ihm
verkrampft vor, wie ein lustlos vollzogenes Ritual. Also schwamm er an
das Ufer zurück und setzte sich an den Strand. Am südwestlichen
Horizont tauchte ein Frachtschiff auf, das kaum sichtbar im fernen Dunst
bedächtig ostwärts zog. Nachdem die Sonne seinen Körper getrocknet
hatte aß er die Äpfel. Ihr Saft spritzte ihm ins Gesicht und tropfte ihm aus
dem Mundwinkel auf den Bauch und die Oberschenkel, um sich dort mit
dem Salz auf seiner Haut zu vermischen. Mit seinem Handtuch wischte
er sich die klebrige Mischung vom Körper. Das war es dann wohl,
murmelte er, zog sich an und setzte seine Wanderung fort.
Am Ende des Strandes deuteten hin und wieder rote Farbmakierungen
auf den Steinen den weiteren Verlauf des Weges an. Das Meer war
plötzlich unruhig geworden. Wellen schlugen gegen die Steine und
manchmal spritzte ihm Wasser ins Gesicht. Er mußte sich mühsam
zwischen den massiven Felsen hindurch zwängen. An einer Stelle
drängte sich der Steilhang soweit an das Wasser heran, das er sich, eine
ruhige Phase der Brandung abwartend, nur mit Mühe trockenen Fußes
und ohne zu stürzen, an der Wand entlang hangeln konnte. Er wuchtete
seinen Rucksack nach, das er besser saß und setzte seinen Weg fort.
Nach etlichen Metern des Balancierens über grobe Steine in der Gischt
der immer heftiger anbrandenden Wellen, wiesen die Farbmakierungen
zu einem Rinnsal, der den Anfang des Weges die Wand hinauf makierte.
Kaum das er der feuchten, dabei kühlenden Nähe des Wassers
entstiegen war, spürte er die volle Kraft der Sonne. Seine
Kleidungsstücke waren schnell schweißdurchnässt. Der Pfad verlief
teilweise so steil, das er sich in einer vornübergebeugten Haltung den
Hang hinauf mühte, wobei er - ohne sich sonderlich zu bücken - den Weg
vor sich berühren konnte. Polternd stürzten einzelne, losgetretene Steine
in die Tiefe. Das Brausen der Brandung verlor zunehmend an Kraft je
höher er kam.
Obgleich ihm der Schweiß aus allen Poren strömte und es immer weiter
hinaufging, immer höher ohne ein Ende nehmen zu wollen, stieg er
Schritt um Schritt ohne zu ermüden. Er fühlte sich wie hinaufgetragen.
Sein Körper hatte sich an die Wanderungen unter heißer Sonne gewöhnt.
Hinter einem besonders steilen Abschnitt verlief der Weg plötzlich eben.
Auch war er viel breiter als zuvor. Ein gute Stelle um eine kleine Pause
einzulegen und auch um die Aussicht zu genießen. Mit einem Schwenke
ließ er den Rucksack auf den Boden gleiten und plazierte ihn an der
Felswand, die vom Pfad aufsteigend bis in den Himmel zu reichen
schien. Er setzte die Wasserflasche an und mit ein paar kräftigen Zügen
leerte er sie zu einem Drittel. Sogleich schoß aus seinem Körper der
Schweiß. An den Felsen entlang säuselnder Wind kühlte, so das er für
einen Augenblick sogar fröstelte.
Der Himmel im Westen schien von der Sonne fast gefüllt. Weit draußen
am Horizont konnte er noch eben das Frachtschiff im fahlen Dunst
eintauchen sehen. Verlassen lag das Meer nun zu seinen Füßen - wie die
Ewigkeit. Zum Horizont hin war das Wasser blau und tausendfach
spiegelte sich das Sonnenlicht in kleinen, silbern blitzenden Kämmen.
Mehr zur Küste hin nahm das Wasser verschiedene Farben an: blau,
grau, an manchen Stellen smaragdfarbend. Und überall waren schwarze
Flecken zu sehen. Sie stammten von Felsen, die bis dicht unter die
Wasseroberfläche ragten. Wo sie aus dem Wasser schauten, schäumte
das Meer. Vor seinen Füßen tief unten schlug die Brandung wütend an
die Felsküste zwischen all' den losgebrochenen Steinen, die sich noch
scharfkantig behaupteten.
Sein Atem war ruhiger geworden. Er stellte die Wasserflasche neben den
Rucksack und schabte mit den Füßen über den Weg. Ein paar Kiesel
rollten den Pfad hinab und verloren sich irgendwo im Geröll. Dann brach
er einen größeren Stein aus dem Weg und drängte ihn an den Rand des
Abhanges. Doch bevor er ihn postiert hatte, rollte der Stein langsam - wie
von einer geheimnisvollen Kraft getrieben - zur Felswand und dann
einige Meter den Weg zurück. Er schaute dem Stein nach, wie einem
Tier, das sich verflüchtete, als fürchtete es die Tiefe. Ein paar hundert
Meter vor ihm erhob sich ein Vogel aus den Felsen und zog im Gleitflug
dicht über der schäumenden Brandung die Küste entlang, bis er nahe an
ihn herangekommen war. Dann schwenkte der Vogel auf das offene Meer
hinaus, flog dem Horizont entgegen bis nur noch ein kleiner Punkte zu
erkennen war, der sich in einem weiten Bogen der Küste wieder näherte
und der - vom Aufwind getragen - irgendwo an der Felswand landete.
Er bückte sich und zerrte mit beiden Händen einen handtellergroßen
Stein aus der brüchigen Felswand. Ruhig, als wäre es ein Kunstwerk,
beschaute er sich das Bruchstück von allen Seiten. Die Oberfläche war
porig, aber sonst war der Stein hart. Wieviel Leben sich wohl in den
winzigen Schlünden, Ritzen und Höhlungen verbarg? Mikroskopisch
winziges Leben, für das dieser Stein so groß war wie für ihn die
Felsenküste. Er hohlte aus und warf den Stein in einem weiten Bogen
über den Abgrund. Dabei erinnerte er sich der Postkarte, während der
Stein sich schnell drehend der Brandung entgegen stürzte.
Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig, vierund... - lautlos
gegen das Dröhnen der Brandung zersplitterte der Stein auf einem
stumpf aus dem Meer ragenden Felsen und einen Moment tänzelten
seine Splitter in der Luft, bevor sie in das Meer eintauchten.
Drei Sekunden, gut drei Sekunden, dachte er, so tief ist es hier! Er stellte
sich eine Zahlenreihe vor. Vom Minus in den Plusbereich. Nicht weit ins
Plus: nur drei, vier Stellen, das würde reichen, bis dahin, dann würde es
aus sein. Er schloß die Augen und zählte, konzentriert auf jeden Moment,
dann spürte er einen Windzug vom Meer heraufkommend, das
Gedächtnisbild der Küste verblaßte, machte Platz für eine wage
Erinnerung. Plötzlich dieser Schrei. Er öffnete die Augen und starrte in
den Himmel. Hoch über ihm kreiste ein Vogel. Er schaute ihm nach, mit
seinem Blick folgte er der Möwe aufs Meer, von wo sie nochmals rief. Ja,
ich bleib; keine Sorge, rief er ihr verhalten nach, trat vom Abhang zurück
und lehnte sich erschöpft gegen die Felswand. Vor seinen Augen
flimmerten schwarze Flecken und kalter Schweiß bildete sich ihm auf der
Stirn.
Langsam erholte er sich. Der
Schweiß juckte und fahrig wischte er
ihn ab. Dann zog er sich seinen
Rucksack auf den Rücken und stieg
den Weg weiter hinauf. Nun spürte er
wie ausgelaugt er war. Der Weg
wurde flacher und bald schon konnte
er die Straße sehen. Aus der Ferne
hörte er einen Bus mit gequältem
Motor nahen. Jetzt war es nicht mehr
weit bis nach Hora Sfakion.
(c) Klaus Dieter Schley