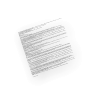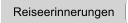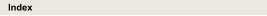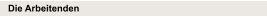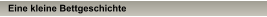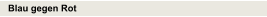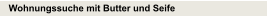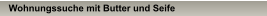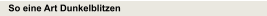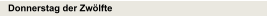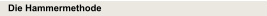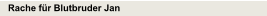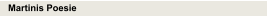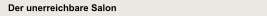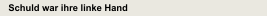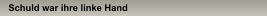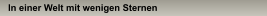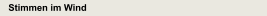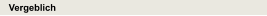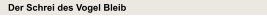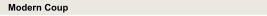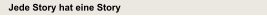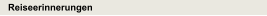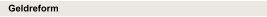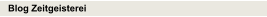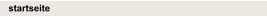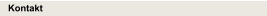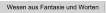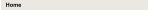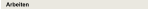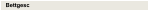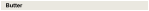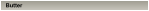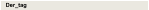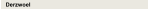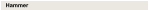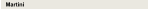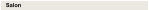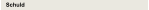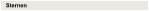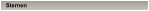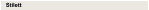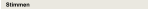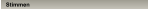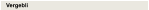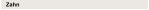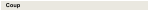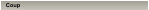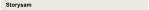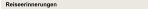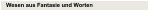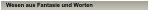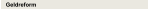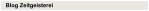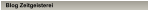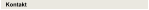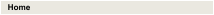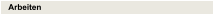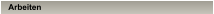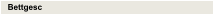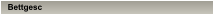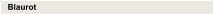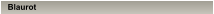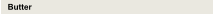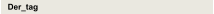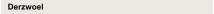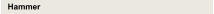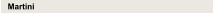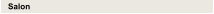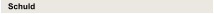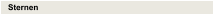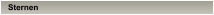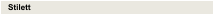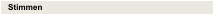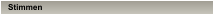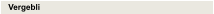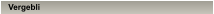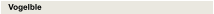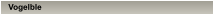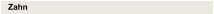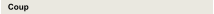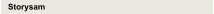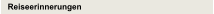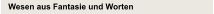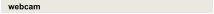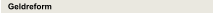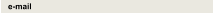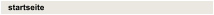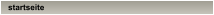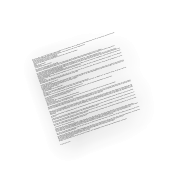


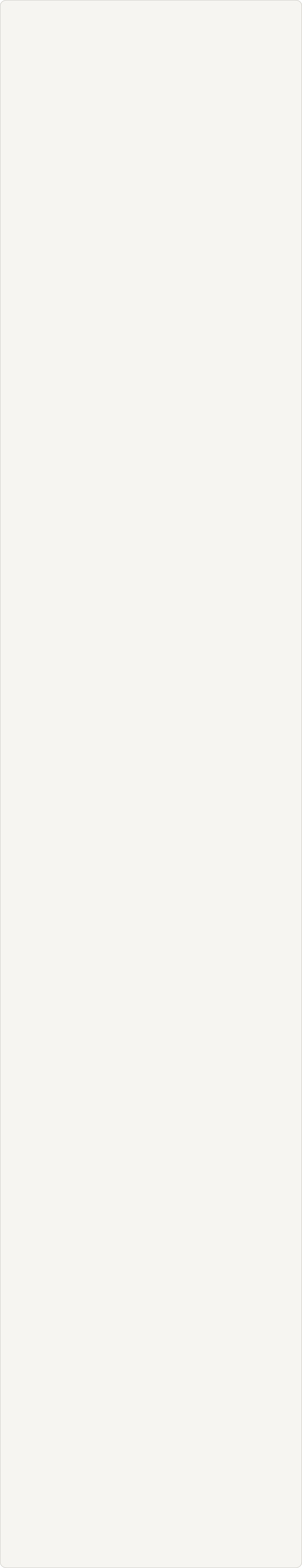
Das Stilett und die Vernissage
oder
Fingerübungen mit dem wabbeligen Hirn des Lesers
Sabine befand sich im Badezimmer und bereitete sich auf die Vernissage vor. Die Badezimmertür
war halb geöffnet und wenn ich zur Seite schaute konnte ich sie sehen. Sie hatte geduscht, stand
nackt vor dem Spiegel und föhnte ihr Haar.
Ich saß an meinem Schreibtisch. Vor mir stand der Bildschirm des PC. Hinter dem Schreibtisch war
das große Fenster unseres Apartment im siebten Stock, von dem aus es einen weiten Blick über
den Park gab, über die daran anschließende Bahnanlage hinüber zum Neubauviertel.
Den PC hatte ich eingeschaltet. Die Seite war weiß und rein gleich einer sauberen Tafel. Aber was
hatte das schon zu bedeuten, rein und sauber? Ich tippte in die Tasten und sofort erschienen
Buchstaben wie aus dem Nichts auf dem Bildschirm:
Ich sitze vor meinem PC. Sabine befindet sich im Badezimmer. Sie macht sich fertig für die
Vernissage. Ich ziehe die unterste Schreibtischschublade auf, wühle zwischen irgendwelchen
Schriftstücken, halte den Brieföffner einen Augenblick nachdenklich in der Hand, lege ihn aber
zurück und suche weiter bis ich es gefunden habe, das Stilett.
Das Stilett ist griffig. Ich wiege es in meiner Hand und schaue hinüber zur Badezimmertür. Sabine
steht nackt vor dem Spiegel und föhnt ihre Haare. Wenn sie nass sind, schauen sie schwarz aus,
obwohl Sabine brünett ist. Markant aber ist ihr Po wenn sie so unbefangen vor dem Spiegel steht
und sich föhnt. Er verformt die Perspektive meiner Wahrnehmung und gerät zum bestimmenden,
meinen Blick konzentrierenden Mittelpunkt. Sabine ist schlank, wohl geformt mit heller makelloser
Haut. Wie warme Milch. Ihr milchwarme helle Haut und das Rot ihrer Lippen. Ein dunkles, dabei
aufreizend natürliches Rot. Milch und Blut. Wärme und Leben. Das Stilett schmiegt sich mit seinem
spürbaren Gewicht in meine Hand, als wäre es ein natürlich gewachsenes Werkzeug - taxiert im
Gewicht und in Entschlossenheit. Ich lege es neben die Tastatur auf den Schreibtisch. Vor dem
dämmernden Abend sehe ich Sabine gespiegelt im Fensterglas, umhüllt vom gelben Licht des
Badezimmers. Sie hat ihr Haar geföhnt, nun bürstet sie es. Dabei legt sie ihren Kopf zur Seite und
lässt das Haar auf die rechte Schulter fallen.
"Wie spät ist es?" rief Sabine.
"Es ist noch Zeit!" antwortete ich.
"Was heißt noch Zeit? Arbeitest du?"
"Ja!"
Ich schaute eine Weile auf den Text meines Bildschirmes. Dann öffnete ich die unterste
Schreibtischschublade und suchte das Stilett. Zunächst legte ich es neben die Tastatur, dann stand
ich auf, packte den Griff fest in meine Faust und stieß das Messer in die Tischplatte. Leicht geneigt
blieb es in dem Holz stecken.
"Was ist los? Ist die etwas runter gefallen?"
Ich schrieb:
Das Stilett steckt in der Tischplatte. Griffbereit. Es federt kaum wenn ich dagegen stoße. Sabine hat
mich gefragt, ob mir etwas runter gefallen sei. Sie weis weder, das ich ein Stilett besitze, noch das
ich es in die Tischplatte gerammt habe.
"Bist du taub oder lebst du nicht mehr?"
"Wieso?"
"Ich hatte gefragt, ob dir etwas runter gefallen sei!"
"Ja."
"Kaputt?"
"Nein."
Ich konnte Sabine nicht mehr sehen. Die Tür des Badezimmers war fast geschlossen. Ich hörte sie
im Toilettenschrank kramen und ich schrieb:
Sabine ist meinen Blicken verborgen. Es wird noch ein langer Abend, eine lange Nacht. Ich sehne
mich auf die andere Seite der Welt, an einem weißen Strand vor einem türkisfarbenen Meer.
Sabine sitzt vor mir im Sand und ich reiche ihr eine Kokosnuss. Hinter uns startet ein Düsenjet
dröhnend in einen grau blauen Himmel. Sabine lächelt als ihr die Kokosmilch von den Lippen auf
die Brust tropft.
"Willst du dich nicht umziehen?"
Sabine stand in ihrem weißen Bademantel gehüllt in der Badezimmertür.
"Es ist noch Zeit", sagte ich.
Sie stieg die Wendeltreppe hinauf in die Schlafebene unseres Apartment. Ich stand auf und stellte
mich an das Fenster. Über der Stadt spannte sich eine graue Wolkendecke. Ich schaute hinunter in
den Park. Ein paar Sträucher und Bäume ließen zaghaftes Grün erkennen. Von unserem Apartment
aus war der Park vollständig zu überblicken. Und weil die Bäume noch keine Blätter trugen waren
die meisten Wege und viele Winkel einsehbar. Zunächst glaubte ich, dass sich in dem Park kein
Menschen befand. Doch dann entdeckte ich einen Jogger in einem hellgrauen Jogginganzug. Er
war nicht allein, wie ich gleich darauf feststellte. Auf der anderen Seite, bei den Gleisen, lief noch
einer, gekleidet in einem dunkelblauen Jogginganzug.
Sie werden sich nicht sehen können, dachte ich. Vielleicht weis der eine nichts von dem anderen
und jeder glaubt zu dieser Stunde allein in dem Park zu sein. Andererseits dachte ich, nein ich
fühlte es, dass die beiden etwas miteinander zu tun hatten, selbst wenn sie sich nicht kannten und
nichts voneinander wussten. Mir war, als sei nun der Abend gekommen, an dem sie etwas
miteinander zu tun bekämen. Vielleicht versackten sie später zusammen in einer Kneipe um ihren
Durst zu stillen. Oder sie lernten sich auf der Vernissage kennen, einander vorgestellt von Sabine.
Ein Güterzug rattert über das Gleis- und Weichengewirr und zerriss meine Gedanken. Da entdecke
ich noch eine Gestalt. Sie bewegt sich auf eine Bank zu, die genau dem spitzwinkeligen
Schnittpunkt zweier langer Wege gegenüber stand. Die Gestalt setzte sich auf die Bank und wühlte
in einer Tüte. Es war eine ältere Frau, die Abend für Abend in dem Park Tauben fütterte.
"Ich finde, du solltest das weiße Jackett anziehen" rief Sabine. "Das würde gut passen?"
"Wieso? Sind die Ausstellungsstücke schwarz?"
Ich ging an den Schreibtisch zurück und tippte in die Tasten:
Während zwei jüngere Männer durch den Park joggen geht eine alte Frau zu einer Parkbank die im
Schnittpunkt zweier spitzwinkelig aufeinander zulaufender Wege steht. Mir ist der Name der Frau
nicht bekannt, dennoch kenne ich sie, denn sie kommt jeden Abend um die Tauben zu füttern. Sie
wohnt in irgend einem der gesichtslosen Mietshäuser, die in einer Zeile entlang einer benachbarten
Straße stehen. Bestimmt ist ihr Mann schon vor längerer Zeit gestorben, und so geht sie in den
Abendstunden in den Park, nicht nur um die Tauben zu füttern, sondern auch, um mit jemanden
gesprochen zu haben, bevor sie in die Einsamkeit eines langen Fernsehabend taucht. Die beiden
Jogger aber drehen ihre Runden und Sabine hat mich aufgefordert, das weiße Jackett zu tragen.
Weiß, wie die Wärme der Milch. Und schon stelle ich mir Flecken auf dem Tuch vor. Rote Flecken.
Mein Jackett baumelte zwischen den Stangen der Wendeltreppe.
"Da ich annehme, dass du dich nicht so schnell hinauf bequemen wirst, reiche ich dir deine Sachen
runter", rief Sabine und wackelte fordernd mit dem weißen Teil. Ich stand auf und nahm das Jackett
wie die anderen Kleidungsstücke entgegen. Dann legte ich sie auf die Couch. Ich verteilte sie so,
dass die ganze Couch von den Kleidungsstücken eingenommen wurde. Auf der Rückenlehne in der
Mitte das Hemd, auf die Sitzfläche unterhalb den Schlips, rechts vom Hemd die Hose, links das
Jackett, die Socken je einen über die Rückenlehne ganz rechts und links, die Unterwäsche links
und rechts über die Seitenlehnen. Eine Weile bemühte ich mich die Kleidungsstücke so zu legen,
das je eines neben dem anderen gestaltet war und so zu dem ganzen in einer irgendwie gewollten
Beziehung stand. Die Couch war nun bekleidet; ein Mensch war in ihr eingegangen und hatte sein
Äußeres in skurriler Weise auf dem Möbel hinterlassen: als ein Zeugnis seiner vergangenen
Existenz. Sabine nieste. "Gesundheit!" rief ich und setzte mich an meinem Schreibtisch zurück.
Auf die Couch habe ich meine Kleidungsstücke verteilt. Die Kleidungsstücke, das Stilett in der
Tischplatte, das weiße Jackett und rotes Blut. Ich sitze vor meinem PC und arrangiere. Ich tippe
Buchstabe für Buchstabe in das Gerät, schaffe Buchstabengruppen mit einer Vielzahl von
Bedeutungen, die ich in einer regelhaften Beziehung setze. Ich arrangiere Bilder, Gedanken,
Abläufe. Ich wecke Vorstellungen, Erwartungen, Ahnungen. Ich spiele mit dem Hirn meiner Leser.
Es ist eine schwabbelige, unförmige Masse, die ich mit meinen Arrangements zu jonglieren trachte.
Es gilt als normal wenn es auch absurd ist. Es gefällt mir - mehr vielleicht als meinen Lesern.
Ich schaue mich um. Sabine hatte sich geduscht, sie bereitete sich für die Vernissage vor und hat
sich nebenbei Gedanken gemacht, in welcher Kleidung ich ihr zur Seite stehen soll. In dem spät
winterlichen Park vor unserem Haus hat sich eine alte Frau auf eine Bank gesetzt und füttert
Tauben. Zwei Jogger eilen über die verschlungenen Wege. Hin und wieder donnert ein Zug über
die Gleisanlage hinter dem Park. Der Himmel über allem ist grau und wird zunehmend dunkler. Die
Hälfte der Autos fährt schon mit Licht.
Ich stand auf und ging zum Fenster. Die alte Frau war von Tauben umringt. Sie streute Brotbrocken
aus und wackelte mit dem Kopf.
"Wie spät ist es?" rief Sabine.
"Spät! Es wird schon dunkel."
"Tatsächlich? - Danke!"
Welches Ziel hat ein Jogger? Den Ausgangspunkt? Trotz wechselnder Richtungen läuft er im Kreis.
Ich trat dicht an die Fensterscheibe heran. Vogelgesang war deutlich zu hören und im
Neubauviertel leuchtete ein Fenster nach dem anderen auf. Ein Eilzug schlängelte sich durch die
Weichen der Gleisanlage, als ein Jogger auf einem der geraden Wege einschwenkte, der direkt auf
die Bank mit der alten Frau führte. Und wie verabredet hatte nun auch der zweite Jogger den
anderen geraden Weg erreicht. Sie hatten ihre Runde gelaufen. Kannten sie sich wirklich nicht und
wussten sie nicht voneinander? War das, was sich vor meinen Augen abspielte ein Arrangement
des Zufalls?
Ich schaute hinüber zu meinem Schreibtisch. Das Stilett steckte schräg in der Tischplatte. Es hatte
etwas vergessenes an sich; etwas von einem vergangenen Ereignis. Es war Gegenstand einer Tat,
die sich nicht erklären ließ. Etwas musste vorgefallen sein, signalisierte das Messer, ohne dabei
auch nur anzudeuten was. Es war ein absurde Tatsache, die mehr Fragen aufwarf und
Assoziationen freisetzte als jemals beantwortbar wären. Ein unendliches Spiel mit Vorstellungen
und Möglichkeiten.
Die alte Frau warf den Tauben einen Brotbrocken nach dem anderen vor und wackelte mit ihrem
Kopf. Die Jogger liefen auf den Schnittpunkt der Wege zu und ich stand am Fenster und schaute
hinunter in den Park. Sabine stieg die Wendeltreppe hinab. Die Jogger hatten fast den Schnittpunkt
erreicht, sie waren jetzt auf der Höhe der Hecke. Ich spürte, wie Sabine auf der Treppe stehen blieb
und schaute. Sie schaute zum Kleiderarrangement auf der Couch, sie schaute zum Fenster, sah
mich dort stehen und sie überlegte. Ich spürte, wie sie mich anschaute und wie sie nach einer
Erklärung für das Gesehene suchte. Die Jogger hatten den Schnittpunkt erreicht: der eine
schwenkte nach links, der andere nach rechts. Sie stießen gegeneinander und taumelten. Einer
sank rücklings auf den Kies. Die Frau hörte auf mit dem Kopf zu wackeln und die Tauben flatterten
in die Luft.
"Bist du dir bewusst, das wir gleich einen Termin haben?" sagte Sabine. Ich hörte, wie sie die
restlichen Stufen hinab stieg. Langsam drehte ich mich um. Sabine schaute zwischen der Couch
und mir hin und her. Als sich unsere Blicke trafen wurde ihr Gesichtsausdruck nachdenklich.
"Ist etwas?" fragte sie.
"Nein."
"Du schaust so traurig. Will dir dein Text nicht gelingen?"
Ich antwortete nicht sondern ging an meinen Schreibtisch zurück. Sabine hatte sich vor die Couch
gestellt und schaute sich amüsiert mein Arrangement an. Sie hatte mir ihren Rücken zugedreht.
Ihre Haare hatte sie hoch gebunden, so dass ihr Nacken frei war. Ich zog das Stilett aus der
Tischplatte und während ich seine Entschlossenheit in meiner Hand spürte, hörte ich sie gegen die
Couch sprechen:
"Hübsch. - Ja, durchaus, das hat etwas. - Sollten wir mit in die Galerie nehmen. - Könnte Anklang
finden. Bringt vielleicht mehr als deine Texte. - Dumm nur, das unser Auto zu klein ist um das Werk
zu transportieren. Machst du mir das Kettchen zu?"
Sie hielt in ihrer rechten Hand ein dünnes, goldenes Kettchen, mit dessen eigenartigem Verschluss
sie ihre liebe Not hatte. Ich legte das Stilette auf den Schreibtisch und stellte mich dicht hinter sie.
Sie roch gut. Frisch und warm. Ich fasste ihr an die Schultern und konnte sehen, wie sich die feinen
Härchen auf ihrem Nacken bewegten.
"Nein, - doch jetzt nicht", flüsterte sie. "Bitte." Ich nahm das Kettchen und legte es um ihren Hals.
Überraschend schnell gelang es mir das Kettchen zu verschließen. Darauf küßte ich ihr auf den
Nacken. Sie entwandt sich mir und ging zum Badezimmer.
"Sei so lieb und beeile dich. Ich trage eben noch etwas Maske auf."
Über den Park, die Gleisanlagen, über die Stadt legte sich die Nacht. Ich schaltete die
Schreibtischlampe ein, öffnete die unterste Schublade und legte das Stilett hinein. Dann schrieb
ich:
Das große Fenster; der Blick hinab in den Park. Die kopfschüttelnde alte Frau; die Jogger. Sie
werden sich gefangen haben. Sicher ist ihnen nichts geschehen; vielleicht eine Schramme hier,
eine Beule dort. Möglich dass sie lachen. Anlass genug um gemeinsam ein Bier zu trinken.
Das Stilett habe ich in die Schublade zurückgelegt? Warum hatte ich es überhaupt
herausgenommen? Warum habe ich geschrieben, was ich schrieb? Von Sabine, dem Park; von der
Wendeltreppe, der Couch und meinem weißen Jackett? Was kann schon jemand erwarten, der
mein Arrangement der Worte ließt, mein Arrangement der Kleidungsstücke sieht. Zeugen Socken
rechts und links auf einer Couchlehne von Ohren und Worte von Taten?
Die wabbelige Maße Hirn im Kopf eines Lesers. Das warme, empfindsame Fleisch eines
lebendigen Menschen. Das Unverständliche, Ärgerliche, Empörende wie Erschreckende. Etwas
sinnloses, etwas langweiliges. Warum nahm ich das Stilett aus der Schublade, warum besitze ich
überhaupt eines? Warum schreibe ich diesen Text, warum gab es diesen Abend; warum liest
jemand einen solchen Text und mit welchen Erwartungen?
Gleich wie es sei, es wird Zeit, das ich Schluss mache, das ich zu einem Ende komme.
Ich setze einen Punkt. Jenseits des großen Fensters war es unterdessen dunkel geworden. Noch
immer hatte ich mich nicht umgezogen. Es wurde nun wirklich Zeit. Die unterste Schublade stand
etwas hervor, sie war nicht ganz zu. Sollte das etwas zu bedeuten haben? Alles bedeutet ja immer
irgend etwas. Ich überflog meinen Text. Dabei stellte ich mir einen Leser vor. Das reizte mich zum
Lachen und ich beendete das Textprogramm. Auf die Frage: "Datei speichern" reagierte ich mit
einem Knopfdruck: POWER OFF
(c) Klaus Dieter Schley
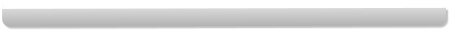
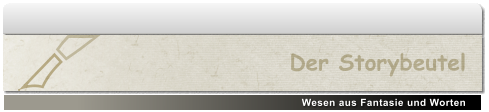
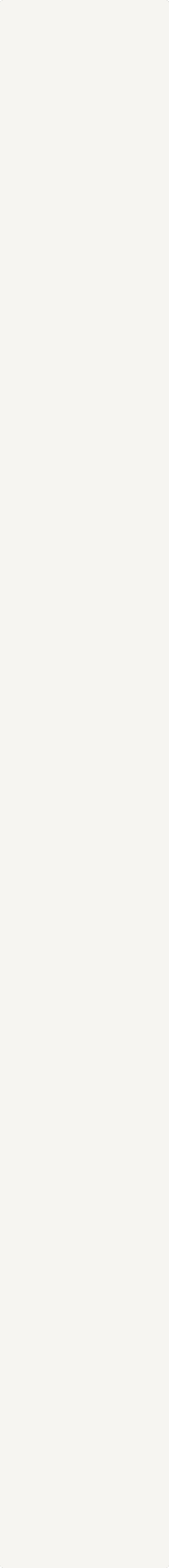
Das Stilett und die Vernissage
oder
Fingerübungen mit dem wabbeligen Hirn
des Lesers
Sabine befand sich im Badezimmer und
bereitete sich auf die Vernissage vor. Die
Badezimmertür war halb geöffnet und wenn ich
zur Seite schaute konnte ich sie sehen. Sie hatte
geduscht, stand nackt vor dem Spiegel und
föhnte ihr Haar.
Ich saß an meinem Schreibtisch. Vor mir stand
der Bildschirm des PC. Hinter dem Schreibtisch
war das große Fenster unseres Apartment im
siebten Stock, von dem aus es einen weiten
Blick über den Park gab, über die daran
anschließende Bahnanlage hinüber zum Neubauviertel.
Den PC hatte ich eingeschaltet. Die Seite war weiß und rein gleich einer
sauberen Tafel. Aber was hatte das schon zu bedeuten, rein und sauber?
Ich tippte in die Tasten und sofort erschienen Buchstaben wie aus dem
Nichts auf dem Bildschirm:
Ich sitze vor meinem PC. Sabine befindet sich im Badezimmer. Sie
macht sich fertig für die Vernissage. Ich ziehe die unterste
Schreibtischschublade auf, wühle zwischen irgendwelchen
Schriftstücken, halte den Brieföffner einen Augenblick nachdenklich in
der Hand, lege ihn aber zurück und suche weiter bis ich es gefunden
habe, das Stilett.
Das Stilett ist griffig. Ich wiege es in meiner Hand und schaue hinüber zur
Badezimmertür. Sabine steht nackt vor dem Spiegel und föhnt ihre
Haare. Wenn sie nass sind, schauen sie schwarz aus, obwohl Sabine
brünett ist. Markant aber ist ihr Po wenn sie so unbefangen vor dem
Spiegel steht und sich föhnt. Er verformt die Perspektive meiner
Wahrnehmung und gerät zum bestimmenden, meinen Blick
konzentrierenden Mittelpunkt. Sabine ist schlank, wohl geformt mit heller
makelloser Haut. Wie warme Milch. Ihr milchwarme helle Haut und das
Rot ihrer Lippen. Ein dunkles, dabei aufreizend natürliches Rot. Milch
und Blut. Wärme und Leben. Das Stilett schmiegt sich mit seinem
spürbaren Gewicht in meine Hand, als wäre es ein natürlich
gewachsenes Werkzeug - taxiert im Gewicht und in Entschlossenheit. Ich
lege es neben die Tastatur auf den Schreibtisch. Vor dem dämmernden
Abend sehe ich Sabine gespiegelt im Fensterglas, umhüllt vom gelben
Licht des Badezimmers. Sie hat ihr Haar geföhnt, nun bürstet sie es.
Dabei legt sie ihren Kopf zur Seite und lässt das Haar auf die rechte
Schulter fallen.
"Wie spät ist es?" rief Sabine.
"Es ist noch Zeit!" antwortete ich.
"Was heißt noch Zeit? Arbeitest du?"
"Ja!"
Ich schaute eine Weile auf den Text meines Bildschirmes. Dann öffnete
ich die unterste Schreibtischschublade und suchte das Stilett. Zunächst
legte ich es neben die Tastatur, dann stand ich auf, packte den Griff fest
in meine Faust und stieß das Messer in die Tischplatte. Leicht geneigt
blieb es in dem Holz stecken.
"Was ist los? Ist die etwas runter gefallen?"
Ich schrieb:
Das Stilett steckt in der Tischplatte. Griffbereit. Es federt kaum wenn ich
dagegen stoße. Sabine hat mich gefragt, ob mir etwas runter gefallen
sei. Sie weis weder, das ich ein Stilett besitze, noch das ich es in die
Tischplatte gerammt habe.
"Bist du taub oder lebst du nicht mehr?"
"Wieso?"
"Ich hatte gefragt, ob dir etwas runter gefallen sei!"
"Ja."
"Kaputt?"
"Nein."
Ich konnte Sabine nicht mehr sehen. Die Tür des Badezimmers war fast
geschlossen. Ich hörte sie im Toilettenschrank kramen und ich schrieb:
Sabine ist meinen Blicken verborgen. Es wird noch ein langer Abend,
eine lange Nacht. Ich sehne mich auf die andere Seite der Welt, an
einem weißen Strand vor einem türkisfarbenen Meer. Sabine sitzt vor mir
im Sand und ich reiche ihr eine Kokosnuss. Hinter uns startet ein
Düsenjet dröhnend in einen grau blauen Himmel. Sabine lächelt als ihr
die Kokosmilch von den Lippen auf die Brust tropft.
"Willst du dich nicht umziehen?"
Sabine stand in ihrem weißen Bademantel gehüllt in der Badezimmertür.
"Es ist noch Zeit", sagte ich.
Sie stieg die Wendeltreppe hinauf in die Schlafebene unseres Apartment.
Ich stand auf und stellte mich an das Fenster. Über der Stadt spannte
sich eine graue Wolkendecke. Ich schaute hinunter in den Park. Ein paar
Sträucher und Bäume ließen zaghaftes Grün erkennen. Von unserem
Apartment aus war der Park vollständig zu überblicken. Und weil die
Bäume noch keine Blätter trugen waren die meisten Wege und viele
Winkel einsehbar. Zunächst glaubte ich, dass sich in dem Park kein
Menschen befand. Doch dann entdeckte ich einen Jogger in einem
hellgrauen Jogginganzug. Er war nicht allein, wie ich gleich darauf
feststellte. Auf der anderen Seite, bei den Gleisen, lief noch einer,
gekleidet in einem dunkelblauen Jogginganzug.
Sie werden sich nicht sehen können, dachte ich. Vielleicht weis der eine
nichts von dem anderen und jeder glaubt zu dieser Stunde allein in dem
Park zu sein. Andererseits dachte ich, nein ich fühlte es, dass die beiden
etwas miteinander zu tun hatten, selbst wenn sie sich nicht kannten und
nichts voneinander wussten. Mir war, als sei nun der Abend gekommen,
an dem sie etwas miteinander zu tun bekämen. Vielleicht versackten sie
später zusammen in einer Kneipe um ihren Durst zu stillen. Oder sie
lernten sich auf der Vernissage kennen, einander vorgestellt von Sabine.
Ein Güterzug rattert über das Gleis- und Weichengewirr und zerriss
meine Gedanken. Da entdecke ich noch eine Gestalt. Sie bewegt sich
auf eine Bank zu, die genau dem spitzwinkeligen Schnittpunkt zweier
langer Wege gegenüber stand. Die Gestalt setzte sich auf die Bank und
wühlte in einer Tüte. Es war eine ältere Frau, die Abend für Abend in dem
Park Tauben fütterte.
"Ich finde, du solltest das weiße Jackett anziehen" rief Sabine. "Das
würde gut passen?"
"Wieso? Sind die Ausstellungsstücke schwarz?"
Ich ging an den Schreibtisch zurück und tippte in die Tasten:
Während zwei jüngere Männer durch den Park joggen geht eine alte
Frau zu einer Parkbank die im Schnittpunkt zweier spitzwinkelig
aufeinander zulaufender Wege steht. Mir ist der Name der Frau nicht
bekannt, dennoch kenne ich sie, denn sie kommt jeden Abend um die
Tauben zu füttern. Sie wohnt in irgend einem der gesichtslosen
Mietshäuser, die in einer Zeile entlang einer benachbarten Straße
stehen. Bestimmt ist ihr Mann schon vor längerer Zeit gestorben, und so
geht sie in den Abendstunden in den Park, nicht nur um die Tauben zu
füttern, sondern auch, um mit jemanden gesprochen zu haben, bevor sie
in die Einsamkeit eines langen Fernsehabend taucht. Die beiden Jogger
aber drehen ihre Runden und Sabine hat mich aufgefordert, das weiße
Jackett zu tragen. Weiß, wie die Wärme der Milch. Und schon stelle ich
mir Flecken auf dem Tuch vor. Rote Flecken.
Mein Jackett baumelte zwischen den Stangen der Wendeltreppe.
"Da ich annehme, dass du dich nicht so schnell hinauf bequemen wirst,
reiche ich dir deine Sachen runter", rief Sabine und wackelte fordernd mit
dem weißen Teil. Ich stand auf und nahm das Jackett wie die anderen
Kleidungsstücke entgegen. Dann legte ich sie auf die Couch. Ich verteilte
sie so, dass die ganze Couch von den Kleidungsstücken eingenommen
wurde. Auf der Rückenlehne in der Mitte das Hemd, auf die Sitzfläche
unterhalb den Schlips, rechts vom Hemd die Hose, links das Jackett, die
Socken je einen über die Rückenlehne ganz rechts und links, die
Unterwäsche links und rechts über die Seitenlehnen. Eine Weile
bemühte ich mich die Kleidungsstücke so zu legen, das je eines neben
dem anderen gestaltet war und so zu dem ganzen in einer irgendwie
gewollten Beziehung stand. Die Couch war nun bekleidet; ein Mensch
war in ihr eingegangen und hatte sein Äußeres in skurriler Weise auf
dem Möbel hinterlassen: als ein Zeugnis seiner vergangenen Existenz.
Sabine nieste. "Gesundheit!" rief ich und setzte mich an meinem
Schreibtisch zurück.
Auf die Couch habe ich meine Kleidungsstücke verteilt. Die
Kleidungsstücke, das Stilett in der Tischplatte, das weiße Jackett und
rotes Blut. Ich sitze vor meinem PC und arrangiere. Ich tippe Buchstabe
für Buchstabe in das Gerät, schaffe Buchstabengruppen mit einer
Vielzahl von Bedeutungen, die ich in einer regelhaften Beziehung setze.
Ich arrangiere Bilder, Gedanken, Abläufe. Ich wecke Vorstellungen,
Erwartungen, Ahnungen. Ich spiele mit dem Hirn meiner Leser. Es ist
eine schwabbelige, unförmige Masse, die ich mit meinen Arrangements
zu jonglieren trachte. Es gilt als normal wenn es auch absurd ist. Es
gefällt mir - mehr vielleicht als meinen Lesern.
Ich schaue mich um. Sabine hatte sich geduscht, sie bereitete sich für
die Vernissage vor und hat sich nebenbei Gedanken gemacht, in welcher
Kleidung ich ihr zur Seite stehen soll. In dem spät winterlichen Park vor
unserem Haus hat sich eine alte Frau auf eine Bank gesetzt und füttert
Tauben. Zwei Jogger eilen über die verschlungenen Wege. Hin und
wieder donnert ein Zug über die Gleisanlage hinter dem Park. Der
Himmel über allem ist grau und wird zunehmend dunkler. Die Hälfte der
Autos fährt schon mit Licht.
Ich stand auf und ging zum Fenster. Die alte Frau war von Tauben
umringt. Sie streute Brotbrocken aus und wackelte mit dem Kopf.
"Wie spät ist es?" rief Sabine.
"Spät! Es wird schon dunkel."
"Tatsächlich? - Danke!"
Welches Ziel hat ein Jogger? Den Ausgangspunkt? Trotz wechselnder
Richtungen läuft er im Kreis.
Ich trat dicht an die Fensterscheibe heran. Vogelgesang war deutlich zu
hören und im Neubauviertel leuchtete ein Fenster nach dem anderen auf.
Ein Eilzug schlängelte sich durch die Weichen der Gleisanlage, als ein
Jogger auf einem der geraden Wege einschwenkte, der direkt auf die
Bank mit der alten Frau führte. Und wie verabredet hatte nun auch der
zweite Jogger den anderen geraden Weg erreicht. Sie hatten ihre Runde
gelaufen. Kannten sie sich wirklich nicht und wussten sie nicht
voneinander? War das, was sich vor meinen Augen abspielte ein
Arrangement des Zufalls?
Ich schaute hinüber zu meinem Schreibtisch. Das Stilett steckte schräg
in der Tischplatte. Es hatte etwas vergessenes an sich; etwas von einem
vergangenen Ereignis. Es war Gegenstand einer Tat, die sich nicht
erklären ließ. Etwas musste vorgefallen sein, signalisierte das Messer,
ohne dabei auch nur anzudeuten was. Es war ein absurde Tatsache, die
mehr Fragen aufwarf und Assoziationen freisetzte als jemals
beantwortbar wären. Ein unendliches Spiel mit Vorstellungen und
Möglichkeiten.
Die alte Frau warf den Tauben einen Brotbrocken nach dem anderen vor
und wackelte mit ihrem Kopf. Die Jogger liefen auf den Schnittpunkt der
Wege zu und ich stand am Fenster und schaute hinunter in den Park.
Sabine stieg die Wendeltreppe hinab. Die Jogger hatten fast den
Schnittpunkt erreicht, sie waren jetzt auf der Höhe der Hecke. Ich spürte,
wie Sabine auf der Treppe stehen blieb und schaute. Sie schaute zum
Kleiderarrangement auf der Couch, sie schaute zum Fenster, sah mich
dort stehen und sie überlegte. Ich spürte, wie sie mich anschaute und
wie sie nach einer Erklärung für das Gesehene suchte. Die Jogger hatten
den Schnittpunkt erreicht: der eine schwenkte nach links, der andere
nach rechts. Sie stießen gegeneinander und taumelten. Einer sank
rücklings auf den Kies. Die Frau hörte auf mit dem Kopf zu wackeln und
die Tauben flatterten in die Luft.
"Bist du dir bewusst, das wir gleich einen Termin haben?" sagte Sabine.
Ich hörte, wie sie die restlichen Stufen hinab stieg. Langsam drehte ich
mich um. Sabine schaute zwischen der Couch und mir hin und her. Als
sich unsere Blicke trafen wurde ihr Gesichtsausdruck nachdenklich.
"Ist etwas?" fragte sie.
"Nein."
"Du schaust so traurig. Will dir dein Text nicht gelingen?"
Ich antwortete nicht sondern ging an meinen Schreibtisch zurück. Sabine
hatte sich vor die Couch gestellt und schaute sich amüsiert mein
Arrangement an. Sie hatte mir ihren Rücken zugedreht. Ihre Haare hatte
sie hoch gebunden, so dass ihr Nacken frei war. Ich zog das Stilett aus
der Tischplatte und während ich seine Entschlossenheit in meiner Hand
spürte, hörte ich sie gegen die Couch sprechen:
"Hübsch. - Ja, durchaus, das hat etwas. - Sollten wir mit in die Galerie
nehmen. - Könnte Anklang finden. Bringt vielleicht mehr als deine Texte. -
Dumm nur, das unser Auto zu klein ist um das Werk zu transportieren.
Machst du mir das Kettchen zu?"
Sie hielt in ihrer rechten Hand ein dünnes, goldenes Kettchen, mit
dessen eigenartigem Verschluss sie ihre liebe Not hatte. Ich legte das
Stilette auf den Schreibtisch und stellte mich dicht hinter sie. Sie roch
gut. Frisch und warm. Ich fasste ihr an die Schultern und konnte sehen,
wie sich die feinen Härchen auf ihrem Nacken bewegten.
"Nein, - doch jetzt nicht", flüsterte sie. "Bitte." Ich nahm das Kettchen und
legte es um ihren Hals. Überraschend schnell gelang es mir das
Kettchen zu verschließen. Darauf küßte ich ihr auf den Nacken. Sie
entwandt sich mir und ging zum Badezimmer.
"Sei so lieb und beeile dich. Ich trage eben noch etwas Maske auf."
Über den Park, die Gleisanlagen, über die Stadt legte sich die Nacht. Ich
schaltete die Schreibtischlampe ein, öffnete die unterste Schublade und
legte das Stilett hinein. Dann schrieb ich:
Das große Fenster; der Blick hinab in den Park. Die kopfschüttelnde alte
Frau; die Jogger. Sie werden sich gefangen haben. Sicher ist ihnen
nichts geschehen; vielleicht eine Schramme hier, eine Beule dort.
Möglich dass sie lachen. Anlass genug um gemeinsam ein Bier zu
trinken.
Das Stilett habe ich in die Schublade zurückgelegt? Warum hatte ich es
überhaupt herausgenommen? Warum habe ich geschrieben, was ich
schrieb? Von Sabine, dem Park; von der Wendeltreppe, der Couch und
meinem weißen Jackett? Was kann schon jemand erwarten, der mein
Arrangement der Worte ließt, mein Arrangement der Kleidungsstücke
sieht. Zeugen Socken rechts und links auf einer Couchlehne von Ohren
und Worte von Taten?
Die wabbelige Maße Hirn im Kopf eines Lesers. Das warme,
empfindsame Fleisch eines lebendigen Menschen. Das Unverständliche,
Ärgerliche, Empörende wie Erschreckende. Etwas sinnloses, etwas
langweiliges. Warum nahm ich das Stilett aus der Schublade, warum
besitze ich überhaupt eines? Warum schreibe ich diesen Text, warum
gab es diesen Abend; warum liest
jemand einen solchen Text und mit
welchen Erwartungen?
Gleich wie es sei, es wird Zeit, das ich
Schluss mache, das ich zu einem Ende
komme.
Ich setze einen Punkt. Jenseits des
großen Fensters war es unterdessen
dunkel geworden. Noch immer hatte ich
mich nicht umgezogen. Es wurde nun
wirklich Zeit. Die unterste Schublade
stand etwas hervor, sie war nicht ganz
zu. Sollte das etwas zu bedeuten haben?
Alles bedeutet ja immer irgend etwas. Ich
überflog meinen Text. Dabei stellte ich
mir einen Leser vor. Das reizte mich zum
Lachen und ich beendete das
Textprogramm. Auf die Frage: "Datei
speichern" reagierte ich mit einem
Knopfdruck: POWER OFF
(c) Klaus Dieter Schley