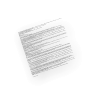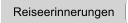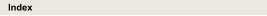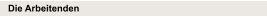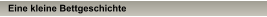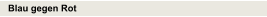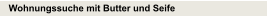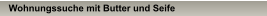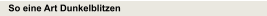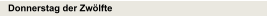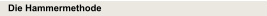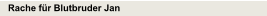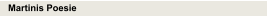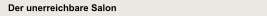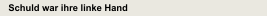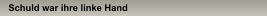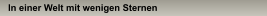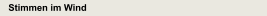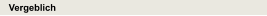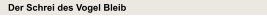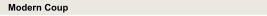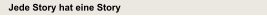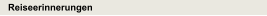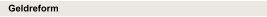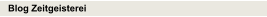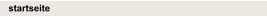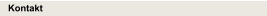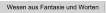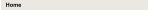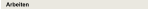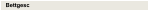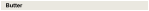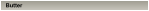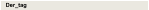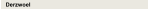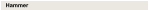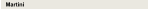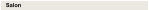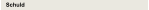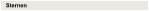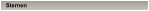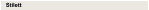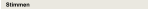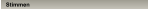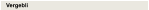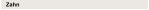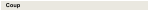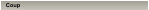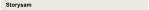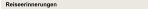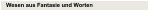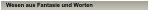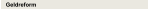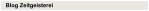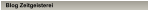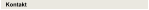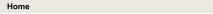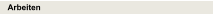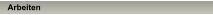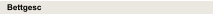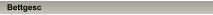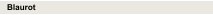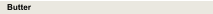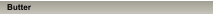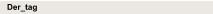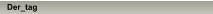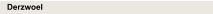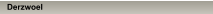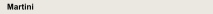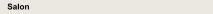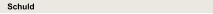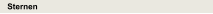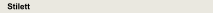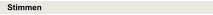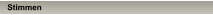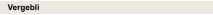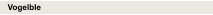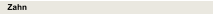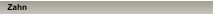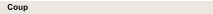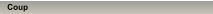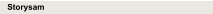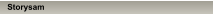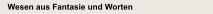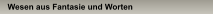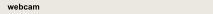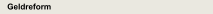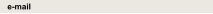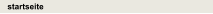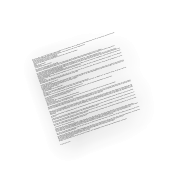


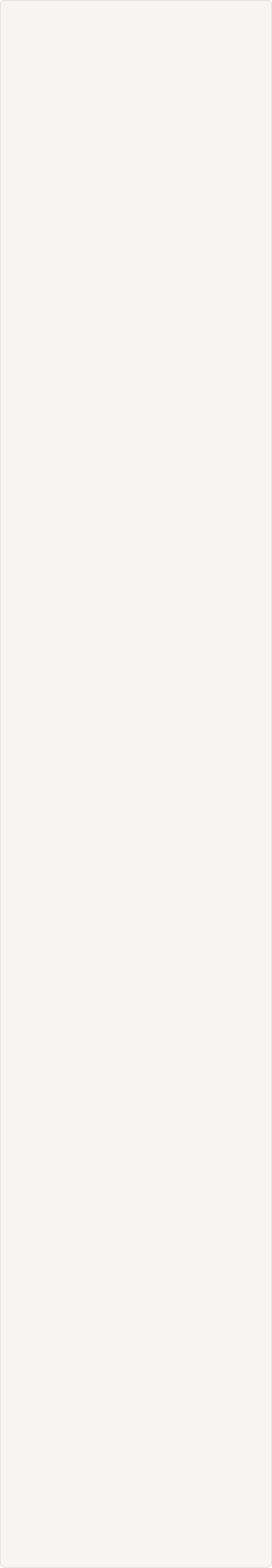
Jede Story hat eine Story
Die Arbeitenden
Die meisten Leute werden mit dieser Geschichte wenig anfangen können, wenn sie auch als merkwürdig und lesbar, also durchaus
mit einem Spannungsbogen versehen, daher kommt. Dennoch: was will sie uns sagen, mag sich so mancher fragen. Was will der
Autor mit dieser Geschichte zum Ausdruck bringen? Nun, sagen wollte ich eigentlich nichts besonderes. Muss denn eine
Geschichte immer eine deutliche Aussage beinhalten?
Diese Geschichte ist mir etwa 1990/1991 „eingefallen“. Ich hatte ein „Bild“ vor mir, das aus Fantasie und eigenen Erfahrungen
beruhte. Während meiner Ausbildung habe ich in einer Metallwerkstatt eine Zeit gearbeitet. Weniger Erfahrungen sondern
mehr bildhafte Erinnerungen, sinnliche Eindrücke drängten sich mir auf, die ich aber in keiner realistischen Weise verarbeiten
konnte. Wie viele meiner Geschichten war auch diese in ihrer Grundstruktur plötzlich einfach da.
Eine kleine Bettgeschichte
Der Titel ist sicher für viele „verfänglich“. In der Umgangssprache wird unter einer „Bettgeschichte“ durchaus etwas anderes
verstanden als ich zum Ausdruck gebracht habe. Irgendwann 1994, 1995 kam mir die Idee zu dieser kleinen Geschichte. Sie hat
zwei Gründe: zum einen die Tatsache, dass das Bett ein wesentlicher Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wir werden an kaum
einem Ort soviel Zeit verbracht haben wie in unserem Bett. Das Bett ist unser zentraler Begleiter durchs Leben.
Diese Tatsache verweist auf den zweiten Grund: Nämlich, das unser „Leben vergeht“. Es vergeht unter diesen oder jenen
Umständen, der Bezugspunkt bei allem was geschieht bleibt aber immer bestehen: unser Bett, genauer Nachtlager, denn „das
Bett“ ist hier ein Synonym für alle möglichen Arten eines Nachtlagers: der Schlafsack am Strand genauso wie vielleicht die
Kartons in einem Hauseingang oder einer Gefängnispritsche - je nach Lebensgeschichte. Diese Bettgeschichte ist also eine von
vielen möglichen Geschichten.
Blau gegen Rot
Die Geschichte ist eine der Geschichten die ich schon vor etlichen Jahren geschrieben und vollendet habe. Irgendwann in den
achtziger Jahren ist sie mir eingefallen, allerdings nicht in der Form, in der sie nun vorliegt. Wie viele meiner Geschichten hat
sie eine mehrjährige Entwicklung hinter sich. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine Art Antikriegsstory schreiben. Nun gehöre
ich zu den Leuten, die sich (glücklicherweise!?) mehr von dem sich entwickelnden Text beeinflussen lassen als von der Absicht,
irgendeine Aussage zu versinnbildlichen. So ist aus der ursprünglichen Absicht nichts geworden, der Text gefiel mir nicht, blieb
liegen, weil ich ihn als gescheitert betrachtete. Die Monate vergehen, aber die Story „wurmt“, sie verlangt danach beendet zu
werden, neue Ideen fließen in die Story ein, wandeln sie und dann haben ich irgendwann einen Text, den ich so „gut“ finde, das
ich mich nicht scheue ihn Lesern vorzulegen.
Um meine Schreibfähigkeiten zu verbessern belegte ich Anfang der neunziger Jahre bei der Axel Anderson Akademie einen
Fernlehrgang in der „Schule des Schreibens“. Nach Abschluss des Lehrgangs hat man die Möglichkeit ein Lektorat zu nutzen,
dass die Story beurteilt und Verlage oder Zeitungen empfiehlt, bei denen eine Story veröffentlicht werden könnte. Dieses
Lektorat habe ich einmal in Anspruch genommen für eine Reihe meiner Storys, darunter „Blau gegen Rot“. Die Geschichte fand
bei den Profis keine Gnade, die Lektorin schrieb mir:
„Die restlichen Manuskripte sind leider vom Inhalt her unbrauchbar. Es handelt sich dabei um Themen, die keine Zeitung
abdruckt, da sie ohne besondere Aussage sind. Was Kinder von Manövern halten, interessiert wirklich keinen Zeitungsleser.“
Ein klares Urteil. Die Storys, die als brauchbar und mit guter Veröffentlichungschance akzeptiert wurden fanden dann
allerdings bei den empfohlenen Verlagen kein Interesse und mein Interesse an ein professionelles Lektorat war damit auch
dahin.
Wohnungssuche mit Butter und Seife
Zwischen 1992 und 1995 habe ich an dieser Geschichte gefeilt. Auslöser war eine Zeitungsmeldung. In dem Artikel wurde von
einer alleinstehenden älteren Frau berichtet, die Annoncen aufgab in der sie eine Wohnung zum vermieten angab. Kamen die
Wohnungssuchenden, wurden sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen und die Frau versuchte sich möglichst lange mit den Leuten
zu unterhalten, bis sich herausstellte, dass sie gar keine Wohnung zu vermieten hatte. Sie suchte in ihrer Einsamkeit nur die
Unterhaltung.
Diese Zeitungsmeldung ist mir nie richtig aus dem Kopf gegangen und eines Tages hatte ich die Idee zu einer Story mit dem
Ergebnis des vorliegenden Textes. So kommt man halt zu seinen Geschichten.
Modern Coup
Was der Auslöser für diese Geschichte war kann ich heute nicht mehr erinnern. Ungefähr 1993 wollte ich eine Geschichte
schreiben, die humorvoll wie spannend, ja erschreckend zugleich ist. Wahrscheinlich hatte ich etwas gelesen oder im Kino/TV
gesehen, in dem lachen und erschrecken sich schlagartig abgelöst haben und so war der Wunsch entstanden ähnliches zu
schaffen. Die Vorstellung wie eine Story auf einen Leser wirken soll war also da, nur von einer Story selbst war weit und breit
nichts vorhanden. Also habe ich angefangen drauf los zu konstruieren, Fragmente geschrieben, aber nichts wollte sich zu einer
Story so recht fügen und frustriert habe ich die Fragmente in die Ecke gepfeffert (Entwürfe oder gescheiterte Texte werfe
ich grundsätzlich nicht weg).
Die Zeit vergeht und in einer „langweiligen Stunde“ auf der Suche nach Material für eine Story wühle ich dann schon mal in
meinen gescheiterten Werken herum und sie da, was mir vor langer Zeit nach reichlich Arbeit als „Mist“ vor kam hatte dann
doch etwas interessantes und plötzlich entwickelte sich die Story. Der nun entstehende Text hat - wie so häufig - mit der
ursprünglichen Intention nicht mehr viel gemein, dafür gefällt, was auf Bildschirm und Papier steht. Und fertig ist das Ding.
So eine Art Dunkelblitzen
Die Geschichte ist 1996 entstanden infolge eines Traumes, den ich während eines längeren Aufenthaltes im Sommer auf Kreta
hatte. Tag für Tag brüllt die Sonne dort im Sommer vom wolkenfreien Himmel, das es manchmal schon zu viel ist. Eines Nachts
hatte ich also einen wirren (Alp-)Traum von dem mir kaum etwas in Erinnerung blieb als ein seltsam beklemmendes Gefühl was
man wohl bekommen würde wenn die Sonne eines morgens nicht mehr am Horizont hoch kriechen würde.
Der Traum, genauer gesagt dieses seltsame traumhafte Angstgefühl, das ich erlebte, fand ich so beeindruckend, schon allein,
weil ich extrem selten Alpträume habe, dass es mich eine Weile beschäftigte. Und was jemanden beschäftigt, der Geschichten
schreibt drängt letztlich danach schriftlich verarbeitet zu werden. Also konstruierte ich eine Story, deren Elemente sich auch
relativ schnell zu einem Text fügten. Die eigentliche Story hat aber nichts mit meinen tatsächlichen Erlebnissen zu tun,
sondern sie ist reine Fantasie wenn auch einzelne Aspekte meiner Erlebnisse und Erfahrungen eingearbeitet sind. Aber ohne
(Lebens-) Erfahrungen könnte man ja eh' keine Geschichten fabulieren.
Donnerstag der Zwölfte
Die Geschichte ist ein reines Produkt meiner Lust Geschichten zu fabulieren ohne das es einen besonderen Grund dazu gegeben
hat. Sie ist mir eingefallen auf der Suche nach einer Geschichte. Es mag vielleicht ein Freitag der 13. gewesen sein, der mich zu
diesem Thema inspirierte, ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern. Begonnen habe ich die Story 1992 aber erst 1993 war
ich damit fertig, weil sie mir zwischenzeitlich nicht recht gelingen wollte, sie also wie die meisten Storys zunächst auf den
Haufen meiner „unvollendeten Werke“ landete.
Die Hammermethode
Zwischen 1993 und 1994 habe ich über diese Story gebrütet. In der Zeit ist die jetzige Fassung entstanden. So weit ich mich
erinnern kann, habe ich aber schon ein paar Jahre zuvor die grundsätzliche Idee zu der Geschichte gehabt. Ursprünglich wollte
ich eine Geschichte schreiben über einen Menschen, der sich in verschiedenen Situationen „absurd“ verhält ohne im eigentlichen
Sinn verrückt zu sein, weil sein Verhalten bewusst gespielt ist. Doch mit dieser Idee bin ich nicht so recht zurande gekommen,
der Text wollte „eigene Wege“ gehen und dann war die vorliegende Geschichte so weit fertig, dass sie nur noch ausgefeilt
werden brauchte.
Rache für Blutsbruder Jan
Zwischen 1991 und 1993 habe ich an der Geschichte immer mal immer wieder gefeilt und ganz zufrieden bin ich mit der Story
noch immer nicht, nur das ich zwischenzeitlich weder an dem Thema noch an dem Text besonderes Interesse habe. Sie wird
also wohl bleiben wie sie ist. Den eigentlichen Anlass oder Beweggrund für die Geschichte kann ich auch nicht mehr erinnern.
Mit der Zeit vergisst man halt so manches.
Martinis Poesie
Irgendwann in den achtziger Jahren habe ich den wesentlichen Teil der Story geschrieben, aber zwischen 1991 und 1995 immer
mal wieder an ihr gefeilt. Die ursprüngliche Absicht war, an einem Text zu arbeiten der nicht im klassischen Erzählstil (meinem
üblichen) geschrieben wird - zum einen, zum anderen fand ich das Plakative der modernen Waren- und Medienwelt interessant
genug für eine Story und so habe ich längere Zeit darüber nachgedacht, wie ich das wohl anstellen könnte, bis sich eben der
Eindruck von meiner Umwelt mit der Lust an einen etwas unkonventionellen Text verband. Aus dieser Zeit unkonventionell mit
Texten umzugehen stammt auch die Story „Vergeblich“. Zu beiden Storys hatte ich aber über lange Zeit ein eher
unbefriedigendes Verhältnis, d.h., ich fand sie nicht gut genug um sie jemanden zum Lesen zu geben. Nachdem die vorliegende
Story aber durchaus von manchen positiv beurteilt wurde gehört sie (ebenso wie „Vergeblich“) nun auch zu der Sammlung
Geschichten für die ich das Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen brauch.
Der unerreichbare Salon
Diese Geschichte hat eine längere Geschichte hinter sich. In der vorliegenden Form habe ich sie zwischen 1993 und 1995
bearbeitet. Ihr Kern führt aber auf den Wunsch zurück, den ich in den achtziger Jahren hatte, nämlich eine Geschichte zu
schreiben in der ein altes, verlassenes Haus im Mittelpunkt steht, denn verlassene Häuser üben auf mich eine gewisse
Faszination aus. Vielleicht liegt das daran, das ich als Kind (etwa um die Zeit des zweiten, dritten Schuljahres herum) mit einem
Spielkamerad bei einem Nachbarn in sein Haus eingebrochen bin. Dieser Nachbar hatte das Haus verkauft, es stand eine Weile
leer bis die neuen Besitzer einzogen. Während dieser Zeit fanden wir heraus, das ein Kellerfenster offen war durch das wir
Knirpse in das Haus schlüpfen und vom Keller bis unterm Dach durch die leeren Räume toben konnten. Eine abenteuerlich-
fantastische Sache, die besonders abenteuerlich wurde, als die neuen Besitzer kamen, während wir in der ersten Etage waren.
Wir versteckten uns in einem Abstellraum und mussten eine ganze Weile warten bis die Leute wieder gegangen waren, so das
wir unentdeckt durch das Kellerfenster zurück in die Freiheit gelangen konnten. Das war es dann auch. Seit jener Zeit
faszinieren mich alte, verlassene Gebäude immer wieder und als ehemaliger Handwerker hatte ich oftmals die Gelegenheit
(legal) in entsprechende Gebäude zu kommen.
Wenn ich durch die leeren Räume gehe, so ist es als dränge das Haus mir seine Geschichte auf, oder das, was ich dem Haus für
eine Geschichte, die es „erlebt“ hat, zuschreibe. Die leeren, verlassenen Räume regen meine Fantasie an (bewohnte, möblierte
Räume dagegen lassen mich vollkommen kalt, genauso wie Neubauten, die allenfalls nach Arbeit stinken). Dieses besondere
Verhältnis zu alten, verlassenen Gebäuden drängte sich natürlich auf in eine Geschichte verarbeitet zu werden in der ein
verlassenes Haus im Mittelpunkt steht. Doch es ist schon so eine Sache mit Storys, die noch vollkommen unförmig im „Bauch“
oder in der Psyche herumlungern: sobald sie in einen Text übergehen sollen, will dieser Texte oft nicht mehr so, wie es das
Gefühl versprach. Der Text will nicht in der ersonnenen und vor gefühlten Rahmen passen und sucht sich seine eigenen Wege.
Das Ergebnis ist (zunächst) dass ich abgrundtief unzufrieden mit dem Text bin, ihn als gescheitert ansehe und ihn auf den
Haufen meiner Fragmente und unvollendeten Werke lege.
Wenn das Textfragment als ganzes meinem Urteil nach auch Schrott ist, einzelne Elemente, Szenen, Beschreibungen haben
etwas, das mich nicht ruhen lässt, dass förmlich danach schreit endlich in eine Story gebettet zu werden. So war es dann auch
mit der vorliegenden Story. Der ursprüngliche Kern ist kaum mehr vorhanden - es geht in der Story nicht um das Haus. Die
geschilderten Geschehnisse sind dagegen nichts als reine Erfindung die im übrigen ein reales Haus mir nie „geflüstert“ hat.
Schuld war ihre linke Hand
Der Titel der Story ist blöd, ich weis und mir wurde es auch schon gesagt. Irgendwann werde ich ihn noch ändern, das aber hat
Zeit. Die Story selbst ist eine Art Lehrlingsarbeit, denn sie entstand im Rahmen meines Fernlehrgangs in der „Schule des
Schreibens“ der Axel Anderson Akademie Anfang der neunziger Jahre. Aufgabe war es, anhand eines vorgelegten Fotos eine
Geschichte zu schreiben von einer maximalen Zeilenzahl. Also brütete das Hirn und heraus kam dieser kleine Psychokrimi. Fotos
oder Bilder eignen sich tatsächlich sehr gut um anhand ihrer „Aussagen“ - die in tausenderlei Richtungen gehen können - munter
drauf los zu fabulieren. Sie sind als Vorlage alle mal besser als wenn man auf der Suche nach einer Story seinen Denkapparat in
den freien dunklen Raum hängt.
In einer Welt mit wenigen Sternen
Diese Geschichte ist genauso wie die Story „Schuld war ihre linke Hand“ infolge einer Aufgabenstellung während meines
Fernlehrganges in der „Schule des Schreibens“ Anfang der neunziger Jahre entstanden. Doch anders als die genannte Story
erlitt ich mit der vorliegenden zunächst einen Schiffbruch:
Vorlage war die Beschreibung einer Szene in der ein Mann auf einem Bahnhof eine Frau verabschiedet. Diese Szene sollte in
eine zu schreibende Story von einer maximal vorgegebenen Länge, genauer Kürze, untergebracht werden. An dieser Vorlage
wäre ich fast gescheitert denn mir wollte nichts gescheites einfallen. Jede „Ehekrise“, jeder Aspekt eines Krimis, einfach alles
was mir dazu einfiel fand ich ganz schnell abgeschmackt, kurz: die vorgelegte Szene, meinte ich, könne nicht in einer leidlich
guten Story vorkommen die nur wenige Zeilen lang sein durfte.
Wäre die zu schreibende Story nicht eine Aufgabe gewesen, ich hätte die Materialien in den Fragmentekasten geworfen und da
würden sie wohl noch heute liegen. Doch die Aufgabe musste gelöst werden. Da die Szene mir nichts sagte setzte ich sie in ein
TV-Gerät, dass in der eigentlichen Story nur im Hintergrund lief. Damit war die Grundlage der vorliegenden Geschichte
geschaffen. In der verlangten Kürze konnte ich aber diese Idee nicht gescheit zu ende formulieren, kürzte über das Maß hinaus
um die Vorgabe zu erfüllen mit dem Ergebnis, dass die Arbeit kein gefallen finden konnte. Später, ohne den Zwang zu kürzen,
schrieb ich sie in die heutige Form.
Das Stilett und die Vernissage
Wenn man halbwegs brauchbare Geschichten zusammen fabuliert dann drückt sich in ihnen nicht nur die eigene Befindlichkeit,
eigene Erlebnisse, ein Wollen oder die Fantasie aus, sondern es findet auch die Frage Eingang, wie die einzelnen Szenen wohl
auf einen Leser wirken werden, ob bei ihm eine vergleichbare Vorstellung hervorgerufen wird über das, was man mit seinem
Text zum Ausdruck bringen möchte. Tatsächlich ist die Wirkung von Texten analysierbar, damit auch Gegenstand der
Grundlagen über den Erzählstil. Es gibt also vereinfacht ausgedrückt Strickmuster, nach denen man Vorstellungen der
gewünschten Art beim Leser hervorrufen kann (zum Beispiel Spannung). Ob das mit dem jeweiligen Text wirklich immer gelingt
ist dann ein anderes Thema.
Als Schreiberling bin ich mir dieser Techniken durchaus bewusst. Ungefähr 1994/95, als ich gerade durch die Gegend radelte,
dachte ich über diesen Umstand nach und hatte Lust mit dieser Technik ein wenig zu spielen. Ja, ich bekam Lust eine
Geschichte zu schreiben, in der ich eigentlich überhaupt nichts erzähle, keinerlei Aussage mache, sondern in der ich nur
Techniken irgendwie aneinanderreihe. Kurz: ich bekam Lust mit der Erwartung eines Lesers, eine möglichst gute Geschichte
erzählt zu bekommen, zu spielen ohne wirklich eine Geschichte erzählt zu haben. Als ich mein Ziel mit dem Rad erreichte
standen auch die Grundelemente meiner Story fest und wieder zu hause begann ich an dem Text zu arbeiten.
Interessant ist, das ich auf diese Story sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen habe. Es gab Leute, die sie sehr gut
fanden und andere die erklärten, die Story wäre ja wohl reiner Blödsinn, womit sie durchaus ein wenig recht haben.
Die Stimmen im Wind
Nach einer kleinen Wanderung auf Kreta legte ich mich leicht ermüdet in den Schatten einer Felswand während hoch über mir
am Rande eines Feldes der Wind in dem Bambuszaun zerrte und ein interessantes Geräusch verursachte. Es hörte sich so an, als
wären die Stimmen vieler sich unterhaltender Menschen ganz leicht zu hören, die irgendwo entfernt auf dem Feld stünden und
deren Unterhaltung durch das zerrende und pfeifende Geräusch des Windes am Zaun fast überdeckt wurde. Geräusche,
Lichtspiegelungen, Gesten von Menschen, Bewegungen; vielerlei Eindrücke sammeln wir mit der Zeit und an manche können wir
uns noch lange erinnern, auch wenn es sich oft nur um nebensächliche Eindrücke handelt.
Diese Stimmen im Wind gab es natürlich nicht. Das was ich mit etwas Fantasie aus den Windgeräuschen heraus gehört hatte
war dennoch von einem bleibenden Eindruck. Gut ein Jahr später, also 1995 fabulierte ich um dieses belanglose akustische
Erlebnis in einer ruhigen Stunde eine Geschichte. Das was dann auf dem Papier stand (ich schrieb diese Geschichte wiederum
auf Kreta am Tisch in einer Taverne bzw. vor meinem Zelt sitzend) wollte mir einfach nicht gefallen, das Fragment landete also
auf den Haufen unvollendeter Geschichten von dem ich es 1996 herunter holte und weiter bearbeitete - bis zur vorliegenden
Story.
Vergeblich
An dieser Geschichte habe ich in den achtziger Jahren herumgewerkelt, auf der Suche nach erzählerischen Effekten. Die
Versuche mit besonderen Satzkonstruktionen diese Effekte zu bewirken sind in der Regel unbefriedigend verlaufen. Zu den
beiden Geschichten, die sich zu einem brauchbaren Text entwickelten, gehörte die vorliegende Story sowie die Story „Martinis
Poesie“.
Der Schrei des Vogel Bleib
Bevor diese Geschichte zu der geworden ist wie sie nun vorliegt hat es lange Jahre gebraucht. Ursprünglich hatte sie einen
starken biographischen Kern. Anfang der achtziger Jahre war ich erstmals auf Kreta. Über die Erlebnisse bei Urlaubsreisen
mögen die meisten Menschen gerne etwas erzählen und ihre Fotos herumreichen. Wenn jemand wie ich zudem noch ein
Schreiberling ist bietet es sich an, seine Erlebnisse schriftlich zu fixieren. Ich wollte etwas von meinen Erlebnissen und der
Atmosphäre aufs Papier bannen. Das war mir dann auch ganz gut gelungen, nur war es keine Story. Es war im Prinzip so nüchtern
wie ein Tagebuch. Doch schon als ich die Texte in die Ecke legte spürte ich, das ich irgend wann einmal auf diese Material
zurückgreifen würde um wirklich eine Story daraus zu machen. Mehrmals versuchte ich mich in den folgenden Jahren daran,
doch nie gefiel mir der Text. 1991 brachte ich es endlich zu einer Geschichte die ich allerdings erst 1995 vollendete. Der
vorliegende Text hat nun aber kaum noch etwas mit meinen eigenen Erlebnissen zu tun. Das meiste an der Geschichte ist ein
reines Fantasieprodukt. Doch so ist es ja meistens bei Geschichten, denn wer erlebt schon eine wirklich für einen Text reife
Story?
Eine seltsame Zahnbehandlung
Vielleicht ist mir diese Geschichte sogar im Wartezimmer beim Zahnarzt eingefallen, ich weis es nicht mehr. Zumindest ist sie
entstanden, weil ich eine Geschichte schreiben wollte und nach einem Stoff suchte. Für diese Geschichte gibt es also keinen
eigentlichen Anlass oder Auslöser. Ungefähr ende der achtziger Jahre habe ich mit ihr begonnen und nach längerer Lagerung
auf meinen Haufen mit „gescheiterten Geschichten“ schrieb ich die endgültige Fassung 1993.
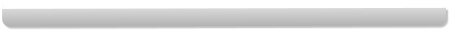
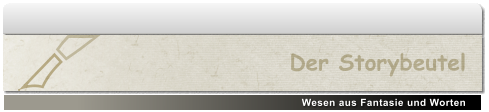
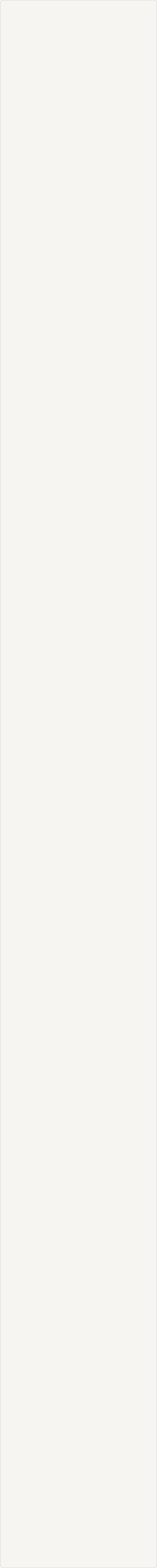
Jede Story hat eine Story
Die Arbeitenden
Die meisten Leute werden mit dieser Geschichte wenig
anfangen können, wenn sie auch als merkwürdig und lesbar, also
durchaus mit einem Spannungsbogen versehen, daher kommt.
Dennoch: was will sie uns sagen, mag sich so mancher fragen.
Was will der Autor mit dieser Geschichte zum Ausdruck
bringen? Nun, sagen wollte ich eigentlich nichts besonderes.
Muss denn eine Geschichte immer eine deutliche Aussage
beinhalten?
Diese Geschichte ist mir etwa 1990/1991 „eingefallen“. Ich
hatte ein „Bild“ vor mir, das aus Fantasie und eigenen
Erfahrungen beruhte. Während meiner Ausbildung habe ich in
einer Metallwerkstatt eine Zeit gearbeitet. Weniger
Erfahrungen sondern mehr bildhafte Erinnerungen, sinnliche
Eindrücke drängten sich mir auf, die ich aber in keiner
realistischen Weise verarbeiten konnte. Wie viele meiner Geschichten war auch diese in ihrer
Grundstruktur plötzlich einfach da.
Eine kleine Bettgeschichte
Der Titel ist sicher für viele „verfänglich“. In der Umgangssprache wird unter einer
„Bettgeschichte“ durchaus etwas anderes verstanden als ich zum Ausdruck gebracht habe.
Irgendwann 1994, 1995 kam mir die Idee zu dieser kleinen Geschichte. Sie hat zwei Gründe:
zum einen die Tatsache, dass das Bett ein wesentlicher Mittelpunkt unseres Lebens ist. Wir
werden an kaum einem Ort soviel Zeit verbracht haben wie in unserem Bett. Das Bett ist
unser zentraler Begleiter durchs Leben.
Diese Tatsache verweist auf den zweiten Grund: Nämlich, das unser „Leben vergeht“. Es
vergeht unter diesen oder jenen Umständen, der Bezugspunkt bei allem was geschieht bleibt
aber immer bestehen: unser Bett, genauer Nachtlager, denn „das Bett“ ist hier ein Synonym
für alle möglichen Arten eines Nachtlagers: der Schlafsack am Strand genauso wie vielleicht
die Kartons in einem Hauseingang oder einer Gefängnispritsche - je nach Lebensgeschichte.
Diese Bettgeschichte ist also eine von vielen möglichen Geschichten.
Blau gegen Rot
Die Geschichte ist eine der Geschichten die ich schon vor etlichen Jahren geschrieben und
vollendet habe. Irgendwann in den achtziger Jahren ist sie mir eingefallen, allerdings nicht in
der Form, in der sie nun vorliegt. Wie viele meiner Geschichten hat sie eine mehrjährige
Entwicklung hinter sich. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine Art Antikriegsstory schreiben.
Nun gehöre ich zu den Leuten, die sich (glücklicherweise!?) mehr von dem sich entwickelnden
Text beeinflussen lassen als von der Absicht, irgendeine Aussage zu versinnbildlichen. So ist
aus der ursprünglichen Absicht nichts geworden, der Text gefiel mir nicht, blieb liegen, weil
ich ihn als gescheitert betrachtete. Die Monate vergehen, aber die Story „wurmt“, sie
verlangt danach beendet zu werden, neue Ideen fließen in die Story ein, wandeln sie und dann
haben ich irgendwann einen Text, den ich so „gut“ finde, das ich mich nicht scheue ihn Lesern
vorzulegen.
Um meine Schreibfähigkeiten zu verbessern belegte ich Anfang der neunziger Jahre bei der
Axel Anderson Akademie einen Fernlehrgang in der „Schule des Schreibens“. Nach Abschluss
des Lehrgangs hat man die Möglichkeit ein Lektorat zu nutzen, dass die Story beurteilt und
Verlage oder Zeitungen empfiehlt, bei denen eine Story veröffentlicht werden könnte. Dieses
Lektorat habe ich einmal in Anspruch genommen für eine Reihe meiner Storys, darunter „Blau
gegen Rot“. Die Geschichte fand bei den Profis keine Gnade, die Lektorin schrieb mir:
„Die restlichen Manuskripte sind leider vom Inhalt her unbrauchbar. Es handelt sich dabei um
Themen, die keine Zeitung abdruckt, da sie ohne besondere Aussage sind. Was Kinder von
Manövern halten, interessiert wirklich keinen Zeitungsleser.“
Ein klares Urteil. Die Storys, die als brauchbar und mit guter Veröffentlichungschance
akzeptiert wurden fanden dann allerdings bei den empfohlenen Verlagen kein Interesse und
mein Interesse an ein professionelles Lektorat war damit auch dahin.
Wohnungssuche mit Butter und Seife
Zwischen 1992 und 1995 habe ich an dieser Geschichte gefeilt. Auslöser war eine
Zeitungsmeldung. In dem Artikel wurde von einer alleinstehenden älteren Frau berichtet, die
Annoncen aufgab in der sie eine Wohnung zum vermieten angab. Kamen die
Wohnungssuchenden, wurden sie zu Kaffee und Kuchen eingeladen und die Frau versuchte sich
möglichst lange mit den Leuten zu unterhalten, bis sich herausstellte, dass sie gar keine
Wohnung zu vermieten hatte. Sie suchte in ihrer Einsamkeit nur die Unterhaltung.
Diese Zeitungsmeldung ist mir nie richtig aus dem Kopf gegangen und eines Tages hatte ich
die Idee zu einer Story mit dem Ergebnis des vorliegenden Textes. So kommt man halt zu
seinen Geschichten.
Modern Coup
Was der Auslöser für diese Geschichte war kann ich heute nicht mehr erinnern. Ungefähr
1993 wollte ich eine Geschichte schreiben, die humorvoll wie spannend, ja erschreckend
zugleich ist. Wahrscheinlich hatte ich etwas gelesen oder im Kino/TV gesehen, in dem lachen
und erschrecken sich schlagartig abgelöst haben und so war der Wunsch entstanden ähnliches
zu schaffen. Die Vorstellung wie eine Story auf einen Leser wirken soll war also da, nur von
einer Story selbst war weit und breit nichts vorhanden. Also habe ich angefangen drauf los zu
konstruieren, Fragmente geschrieben, aber nichts wollte sich zu einer Story so recht fügen
und frustriert habe ich die Fragmente in die Ecke gepfeffert (Entwürfe oder gescheiterte
Texte werfe ich grundsätzlich nicht weg).
Die Zeit vergeht und in einer „langweiligen Stunde“ auf der Suche nach Material für eine
Story wühle ich dann schon mal in meinen gescheiterten Werken herum und sie da, was mir vor
langer Zeit nach reichlich Arbeit als „Mist“ vor kam hatte dann doch etwas interessantes und
plötzlich entwickelte sich die Story. Der nun entstehende Text hat - wie so häufig - mit der
ursprünglichen Intention nicht mehr viel gemein, dafür gefällt, was auf Bildschirm und Papier
steht. Und fertig ist das Ding.
So eine Art Dunkelblitzen
Die Geschichte ist 1996 entstanden infolge eines Traumes, den ich während eines längeren
Aufenthaltes im Sommer auf Kreta hatte. Tag für Tag brüllt die Sonne dort im Sommer vom
wolkenfreien Himmel, das es manchmal schon zu viel ist. Eines Nachts hatte ich also einen
wirren (Alp-)Traum von dem mir kaum etwas in Erinnerung blieb als ein seltsam beklemmendes
Gefühl was man wohl bekommen würde wenn die Sonne eines morgens nicht mehr am Horizont
hoch kriechen würde.
Der Traum, genauer gesagt dieses seltsame traumhafte Angstgefühl, das ich erlebte, fand ich
so beeindruckend, schon allein, weil ich extrem selten Alpträume habe, dass es mich eine
Weile beschäftigte. Und was jemanden beschäftigt, der Geschichten schreibt drängt letztlich
danach schriftlich verarbeitet zu werden. Also konstruierte ich eine Story, deren Elemente
sich auch relativ schnell zu einem Text fügten. Die eigentliche Story hat aber nichts mit
meinen tatsächlichen Erlebnissen zu tun, sondern sie ist reine Fantasie wenn auch einzelne
Aspekte meiner Erlebnisse und Erfahrungen eingearbeitet sind. Aber ohne (Lebens-)
Erfahrungen könnte man ja eh' keine Geschichten fabulieren.
Donnerstag der Zwölfte
Die Geschichte ist ein reines Produkt meiner Lust Geschichten zu fabulieren ohne das es einen
besonderen Grund dazu gegeben hat. Sie ist mir eingefallen auf der Suche nach einer
Geschichte. Es mag vielleicht ein Freitag der 13. gewesen sein, der mich zu diesem Thema
inspirierte, ich kann mich heute nicht mehr daran erinnern. Begonnen habe ich die Story 1992
aber erst 1993 war ich damit fertig, weil sie mir zwischenzeitlich nicht recht gelingen wollte,
sie also wie die meisten Storys zunächst auf den Haufen meiner „unvollendeten Werke“
landete.
Die Hammermethode
Zwischen 1993 und 1994 habe ich über diese Story gebrütet. In der Zeit ist die jetzige
Fassung entstanden. So weit ich mich erinnern kann, habe ich aber schon ein paar Jahre zuvor
die grundsätzliche Idee zu der Geschichte gehabt. Ursprünglich wollte ich eine Geschichte
schreiben über einen Menschen, der sich in verschiedenen Situationen „absurd“ verhält ohne
im eigentlichen Sinn verrückt zu sein, weil sein Verhalten bewusst gespielt ist. Doch mit dieser
Idee bin ich nicht so recht zurande gekommen, der Text wollte „eigene Wege“ gehen und dann
war die vorliegende Geschichte so weit fertig, dass sie nur noch ausgefeilt werden brauchte.
Rache für Blutsbruder Jan
Zwischen 1991 und 1993 habe ich an der Geschichte immer mal immer wieder gefeilt und ganz
zufrieden bin ich mit der Story noch immer nicht, nur das ich zwischenzeitlich weder an dem
Thema noch an dem Text besonderes Interesse habe. Sie wird also wohl bleiben wie sie ist.
Den eigentlichen Anlass oder Beweggrund für die Geschichte kann ich auch nicht mehr
erinnern. Mit der Zeit vergisst man halt so manches.
Martinis Poesie
Irgendwann in den achtziger Jahren habe ich den wesentlichen Teil der Story geschrieben,
aber zwischen 1991 und 1995 immer mal wieder an ihr gefeilt. Die ursprüngliche Absicht war,
an einem Text zu arbeiten der nicht im klassischen Erzählstil (meinem üblichen) geschrieben
wird - zum einen, zum anderen fand ich das Plakative der modernen Waren- und Medienwelt
interessant genug für eine Story und so habe ich längere Zeit darüber nachgedacht, wie ich
das wohl anstellen könnte, bis sich eben der Eindruck von meiner Umwelt mit der Lust an einen
etwas unkonventionellen Text verband. Aus dieser Zeit unkonventionell mit Texten umzugehen
stammt auch die Story „Vergeblich“. Zu beiden Storys hatte ich aber über lange Zeit ein eher
unbefriedigendes Verhältnis, d.h., ich fand sie nicht gut genug um sie jemanden zum Lesen zu
geben. Nachdem die vorliegende Story aber durchaus von manchen positiv beurteilt wurde
gehört sie (ebenso wie „Vergeblich“) nun auch zu der Sammlung Geschichten für die ich das
Licht der Öffentlichkeit nicht scheuen brauch.
Der unerreichbare Salon
Diese Geschichte hat eine längere Geschichte hinter sich. In der vorliegenden Form habe ich
sie zwischen 1993 und 1995 bearbeitet. Ihr Kern führt aber auf den Wunsch zurück, den ich
in den achtziger Jahren hatte, nämlich eine Geschichte zu schreiben in der ein altes,
verlassenes Haus im Mittelpunkt steht, denn verlassene Häuser üben auf mich eine gewisse
Faszination aus. Vielleicht liegt das daran, das ich als Kind (etwa um die Zeit des zweiten,
dritten Schuljahres herum) mit einem Spielkamerad bei einem Nachbarn in sein Haus
eingebrochen bin. Dieser Nachbar hatte das Haus verkauft, es stand eine Weile leer bis die
neuen Besitzer einzogen. Während dieser Zeit fanden wir heraus, das ein Kellerfenster offen
war durch das wir Knirpse in das Haus schlüpfen und vom Keller bis unterm Dach durch die
leeren Räume toben konnten. Eine abenteuerlich-fantastische Sache, die besonders
abenteuerlich wurde, als die neuen Besitzer kamen, während wir in der ersten Etage waren.
Wir versteckten uns in einem Abstellraum und mussten eine ganze Weile warten bis die Leute
wieder gegangen waren, so das wir unentdeckt durch das Kellerfenster zurück in die Freiheit
gelangen konnten. Das war es dann auch. Seit jener Zeit faszinieren mich alte, verlassene
Gebäude immer wieder und als ehemaliger Handwerker hatte ich oftmals die Gelegenheit
(legal) in entsprechende Gebäude zu kommen.
Wenn ich durch die leeren Räume gehe, so ist es als dränge das Haus mir seine Geschichte auf,
oder das, was ich dem Haus für eine Geschichte, die es „erlebt“ hat, zuschreibe. Die leeren,
verlassenen Räume regen meine Fantasie an (bewohnte, möblierte Räume dagegen lassen mich
vollkommen kalt, genauso wie Neubauten, die allenfalls nach Arbeit stinken). Dieses besondere
Verhältnis zu alten, verlassenen Gebäuden drängte sich natürlich auf in eine Geschichte
verarbeitet zu werden in der ein verlassenes Haus im Mittelpunkt steht. Doch es ist schon so
eine Sache mit Storys, die noch vollkommen unförmig im „Bauch“ oder in der Psyche
herumlungern: sobald sie in einen Text übergehen sollen, will dieser Texte oft nicht mehr so,
wie es das Gefühl versprach. Der Text will nicht in der ersonnenen und vor gefühlten Rahmen
passen und sucht sich seine eigenen Wege. Das Ergebnis ist (zunächst) dass ich abgrundtief
unzufrieden mit dem Text bin, ihn als gescheitert ansehe und ihn auf den Haufen meiner
Fragmente und unvollendeten Werke lege.
Wenn das Textfragment als ganzes meinem Urteil nach auch Schrott ist, einzelne Elemente,
Szenen, Beschreibungen haben etwas, das mich nicht ruhen lässt, dass förmlich danach schreit
endlich in eine Story gebettet zu werden. So war es dann auch mit der vorliegenden Story.
Der ursprüngliche Kern ist kaum mehr vorhanden - es geht in der Story nicht um das Haus. Die
geschilderten Geschehnisse sind dagegen nichts als reine Erfindung die im übrigen ein reales
Haus mir nie „geflüstert“ hat.
Schuld war ihre linke Hand
Der Titel der Story ist blöd, ich weis und mir wurde es auch schon gesagt. Irgendwann werde
ich ihn noch ändern, das aber hat Zeit. Die Story selbst ist eine Art Lehrlingsarbeit, denn sie
entstand im Rahmen meines Fernlehrgangs in der „Schule des Schreibens“ der Axel Anderson
Akademie Anfang der neunziger Jahre. Aufgabe war es, anhand eines vorgelegten Fotos eine
Geschichte zu schreiben von einer maximalen Zeilenzahl. Also brütete das Hirn und heraus
kam dieser kleine Psychokrimi. Fotos oder Bilder eignen sich tatsächlich sehr gut um anhand
ihrer „Aussagen“ - die in tausenderlei Richtungen gehen können - munter drauf los zu
fabulieren. Sie sind als Vorlage alle mal besser als wenn man auf der Suche nach einer Story
seinen Denkapparat in den freien dunklen Raum hängt.
In einer Welt mit wenigen Sternen
Diese Geschichte ist genauso wie die Story „Schuld war ihre linke Hand“ infolge einer
Aufgabenstellung während meines Fernlehrganges in der „Schule des Schreibens“ Anfang der
neunziger Jahre entstanden. Doch anders als die genannte Story erlitt ich mit der
vorliegenden zunächst einen Schiffbruch:
Vorlage war die Beschreibung einer Szene in der ein Mann auf einem Bahnhof eine Frau
verabschiedet. Diese Szene sollte in eine zu schreibende Story von einer maximal
vorgegebenen Länge, genauer Kürze, untergebracht werden. An dieser Vorlage wäre ich fast
gescheitert denn mir wollte nichts gescheites einfallen. Jede „Ehekrise“, jeder Aspekt eines
Krimis, einfach alles was mir dazu einfiel fand ich ganz schnell abgeschmackt, kurz: die
vorgelegte Szene, meinte ich, könne nicht in einer leidlich guten Story vorkommen die nur
wenige Zeilen lang sein durfte.
Wäre die zu schreibende Story nicht eine Aufgabe gewesen, ich hätte die Materialien in den
Fragmentekasten geworfen und da würden sie wohl noch heute liegen. Doch die Aufgabe
musste gelöst werden. Da die Szene mir nichts sagte setzte ich sie in ein TV-Gerät, dass in
der eigentlichen Story nur im Hintergrund lief. Damit war die Grundlage der vorliegenden
Geschichte geschaffen. In der verlangten Kürze konnte ich aber diese Idee nicht gescheit zu
ende formulieren, kürzte über das Maß hinaus um die Vorgabe zu erfüllen mit dem Ergebnis,
dass die Arbeit kein gefallen finden konnte. Später, ohne den Zwang zu kürzen, schrieb ich sie
in die heutige Form.
Das Stilett und die Vernissage
Wenn man halbwegs brauchbare Geschichten zusammen fabuliert dann drückt sich in ihnen
nicht nur die eigene Befindlichkeit, eigene Erlebnisse, ein Wollen oder die Fantasie aus,
sondern es findet auch die Frage Eingang, wie die einzelnen Szenen wohl auf einen Leser
wirken werden, ob bei ihm eine vergleichbare Vorstellung hervorgerufen wird über das, was
man mit seinem Text zum Ausdruck bringen möchte. Tatsächlich ist die Wirkung von Texten
analysierbar, damit auch Gegenstand der Grundlagen über den Erzählstil. Es gibt also
vereinfacht ausgedrückt Strickmuster, nach denen man Vorstellungen der gewünschten Art
beim Leser hervorrufen kann (zum Beispiel Spannung). Ob das mit dem jeweiligen Text
wirklich immer gelingt ist dann ein anderes Thema.
Als Schreiberling bin ich mir dieser Techniken durchaus bewusst. Ungefähr 1994/95, als ich
gerade durch die Gegend radelte, dachte ich über diesen Umstand nach und hatte Lust mit
dieser Technik ein wenig zu spielen. Ja, ich bekam Lust eine Geschichte zu schreiben, in der
ich eigentlich überhaupt nichts erzähle, keinerlei Aussage mache, sondern in der ich nur
Techniken irgendwie aneinanderreihe. Kurz: ich bekam Lust mit der Erwartung eines Lesers,
eine möglichst gute Geschichte erzählt zu bekommen, zu spielen ohne wirklich eine Geschichte
erzählt zu haben. Als ich mein Ziel mit dem Rad erreichte standen auch die Grundelemente
meiner Story fest und wieder zu hause begann ich an dem Text zu arbeiten.
Interessant ist, das ich auf diese Story sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen habe. Es
gab Leute, die sie sehr gut fanden und andere die erklärten, die Story wäre ja wohl reiner
Blödsinn, womit sie durchaus ein wenig recht haben.
Die Stimmen im Wind
Nach einer kleinen Wanderung auf Kreta legte ich mich leicht ermüdet in den Schatten einer
Felswand während hoch über mir am Rande eines Feldes der Wind in dem Bambuszaun zerrte
und ein interessantes Geräusch verursachte. Es hörte sich so an, als wären die Stimmen vieler
sich unterhaltender Menschen ganz leicht zu hören, die irgendwo entfernt auf dem Feld
stünden und deren Unterhaltung durch das zerrende und pfeifende Geräusch des Windes am
Zaun fast überdeckt wurde. Geräusche, Lichtspiegelungen, Gesten von Menschen, Bewegungen;
vielerlei Eindrücke sammeln wir mit der Zeit und an manche können wir uns noch lange
erinnern, auch wenn es sich oft nur um nebensächliche Eindrücke handelt.
Diese Stimmen im Wind gab es natürlich nicht. Das was ich mit etwas Fantasie aus den
Windgeräuschen heraus gehört hatte war dennoch von einem bleibenden Eindruck. Gut ein
Jahr später, also 1995 fabulierte ich um dieses belanglose akustische Erlebnis in einer ruhigen
Stunde eine Geschichte. Das was dann auf dem Papier stand (ich schrieb diese Geschichte
wiederum auf Kreta am Tisch in einer Taverne bzw. vor meinem Zelt sitzend) wollte mir
einfach nicht gefallen, das Fragment landete also auf den Haufen unvollendeter Geschichten
von dem ich es 1996 herunter holte und weiter bearbeitete - bis zur vorliegenden Story.
Vergeblich
An dieser Geschichte habe ich in den achtziger Jahren herumgewerkelt, auf der Suche nach
erzählerischen Effekten. Die Versuche mit besonderen Satzkonstruktionen diese Effekte zu
bewirken sind in der Regel unbefriedigend verlaufen. Zu den beiden Geschichten, die sich zu
einem brauchbaren Text entwickelten, gehörte die vorliegende Story sowie die Story
„Martinis Poesie“.
Der Schrei des Vogel Bleib
Bevor diese Geschichte zu der geworden ist wie sie nun vorliegt hat es lange Jahre gebraucht.
Ursprünglich hatte sie einen starken biographischen Kern. Anfang der achtziger Jahre war ich
erstmals auf Kreta. Über die Erlebnisse bei Urlaubsreisen mögen die meisten Menschen gerne
etwas erzählen und ihre Fotos herumreichen. Wenn jemand wie ich zudem noch ein
Schreiberling ist bietet es sich an, seine Erlebnisse schriftlich zu fixieren. Ich wollte etwas
von meinen Erlebnissen und der Atmosphäre aufs Papier bannen. Das war mir dann auch ganz
gut gelungen, nur war es keine Story. Es war im
Prinzip so nüchtern wie ein Tagebuch. Doch schon als
ich die Texte in die Ecke legte spürte ich, das ich
irgend wann einmal auf diese Material zurückgreifen
würde um wirklich eine Story daraus zu machen.
Mehrmals versuchte ich mich in den folgenden
Jahren daran, doch nie gefiel mir der Text. 1991
brachte ich es endlich zu einer Geschichte die ich
allerdings erst 1995 vollendete. Der vorliegende
Text hat nun aber kaum noch etwas mit meinen
eigenen Erlebnissen zu tun. Das meiste an der
Geschichte ist ein reines Fantasieprodukt. Doch so
ist es ja meistens bei Geschichten, denn wer erlebt
schon eine wirklich für einen Text reife Story?
Eine seltsame Zahnbehandlung
Vielleicht ist mir diese Geschichte sogar im
Wartezimmer beim Zahnarzt eingefallen, ich weis es
nicht mehr. Zumindest ist sie entstanden, weil ich
eine Geschichte schreiben wollte und nach einem
Stoff suchte. Für diese Geschichte gibt es also
keinen eigentlichen Anlass oder Auslöser. Ungefähr
ende der achtziger Jahre habe ich mit ihr begonnen
und nach längerer Lagerung auf meinen Haufen mit
„gescheiterten Geschichten“ schrieb ich die
endgültige Fassung 1993.