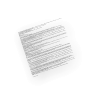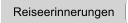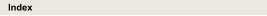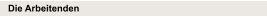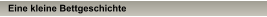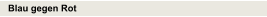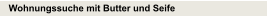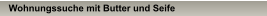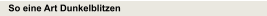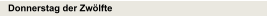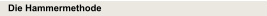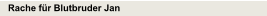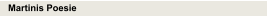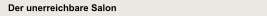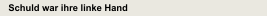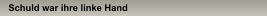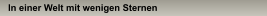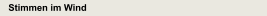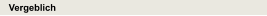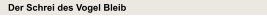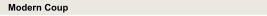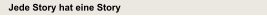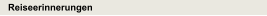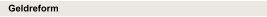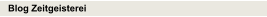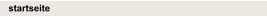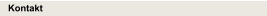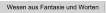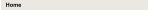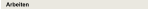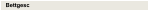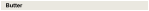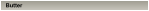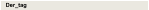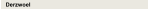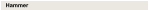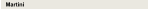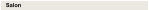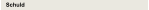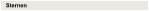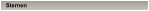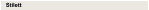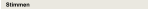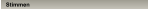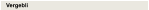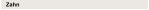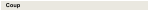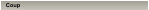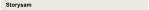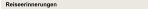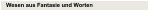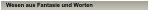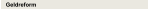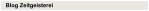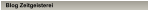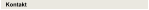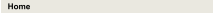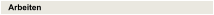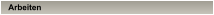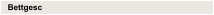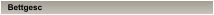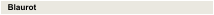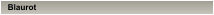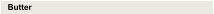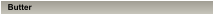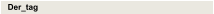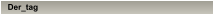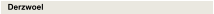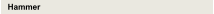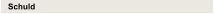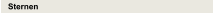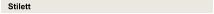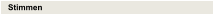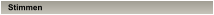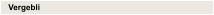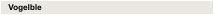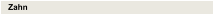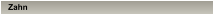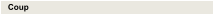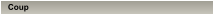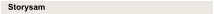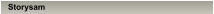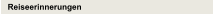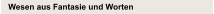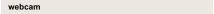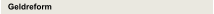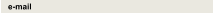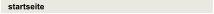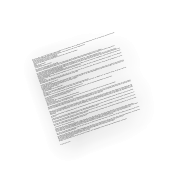


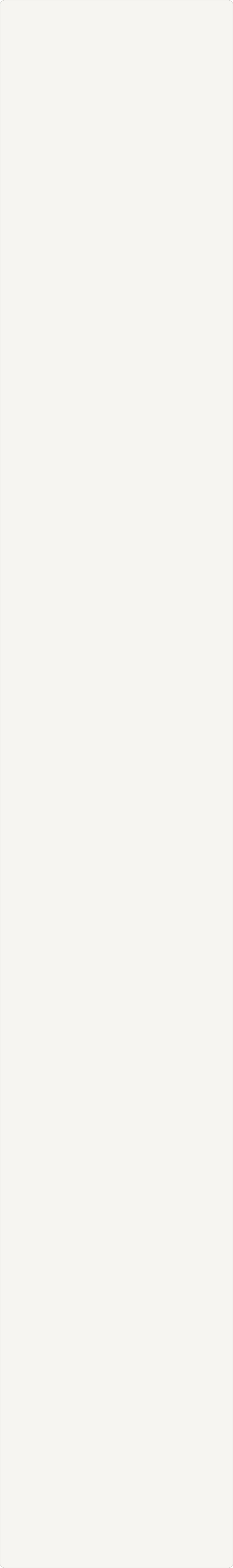
So eine Art Dunkelblitzen
Es war keine Lähmung, die uns daran hinderte, einander in die Arme zu nehmen. Es war die nackte
Angst einen Menschen wirklich zu spüren, seine Haut und seine Wärme zu fühlen und durch seinen
Nähe gleich wie durch sein Zittern zu wissen, dass man nicht träumte. Als ich dann plötzlich Tanja,
die nur einen winzigen Slip an hatte und am Rand des Schwimmbecken gelegen war, niederknien
sah und beten - wie ein kleines Mädchen bei der Erstkommunion, war ich kurz davor in brüllendes
Lachen auszubrechen, wenn ich nicht zugleich das Gefühl gehabt hätte, als wäre mir mein Bauch
aufgeschlitzt worden und ich nun vergeblich versuchte meine heraus drängenden Gedärme nicht zu
verlieren, so als könne ich dadurch dem unausweichlichen Tod entkommen, den ich schon in
meinen Händen hielt.
Wir hatten in der Nacht reichlich getrunken und geraucht, wir hatten gelacht und getanzt und eine
Menge Blödsinn geredet, und zum Schluss haben wir die Party mit einem Bad im Meer unter einem
funkelndem Sternenhimmel abgeschlossen. Da die Nächte auf der kleinen, weltabgewandten Insel
zu dieser Jahreszeit besonders warm waren, legten sich nach dem Baden viele - nur in ein Laken
gewickelt - an den Strand und schliefen einem neuen Tag entgegen.
Weil ich nicht darauf geachtet hatte und etwas Abseits der Tamarisken lagerte, wurde ich schon
bald von den ersten brennenden Sonnenstrahlen geweckt, kaum dass die Sonnen über die Berge
jenseits der Bucht gekrochen war. Ich stand auf, badete im Meer und ging zur Terrasse des
Restaurants, um einen Kaffee zu trinken.
Um diese Zeit hatte ich eigentlich erwartet der erste Gast zu sein. Doch Sonja saß schon an einem
Tisch nahe des Schwimmbecken und hatte vor sich eine Karaffe mit frisch gepresstem Orangensaft
stehen. Ich fragte sie, ob ich mich zu ihr setzen dürfe und sie nickte. Sonja war bekannt als eine
etwas launige Frau, zu der niemand so recht Zugang fand. Sie zog es vor mit dicken Büchern in
eine Ecke zu sitzen und vor allem ging sie früh schlafen, stand dafür aber zeitig auf.
Als ich einen Augenblick gesessen hatte und nach einem Thema suchte, über das ich mich mit ihr
unterhalten könnte, entdeckte ich Pedro, der von den überhängenden Weinstauden im hinteren Teil
der Terrasse mit dem Kopf nach unten baumelte und dabei einen seltsam apathischen Eindruck
machte. Sonja schaute mich plötzlich scharf an, als sie bemerkte, daß ich zu Pedro schaute.
"Findest du das richtig den Tieren Alkohol zu geben", blaffte sie mich an?
Ich schüttelte meinen Kopf weil ich nicht wusste, was sie meinte.
"Du warst doch bestimmt letzte Nacht auch hier oben, als sie Pedro mit Alkohol getränkten
Bananen und Honigmelonen gefüttert haben." Sie wies zum Schimpansen hinüber. "Ich habe das
schon einmal beobachtet und ich muss sagen, ich finde das fies."
Noch ehe ich etwas antworten konnte fuhr sie fort.
"Hexe habt ihr auch alkoholisiert! So winselnd habe ich die arme Hündin noch nie erlebt. Sie
mochte sich nicht einmal von mir streicheln lassen und ist jaulend davongelaufen!"
"Und du glaubst, das kommt vom Alkohol der ihnen von irgend jemanden verabreicht wurde?"
"Ja sicher! Woher sonst?"
"Ich habe natürlich nicht alles gesehen, was letzte Nacht hier geschehen ist, aber glaube mir, ich
habe niemanden beobachtet, der die Tiere gefüttert hat. Ich habe Pedro und Hexe nicht einmal hier
oben gesehen", versuchte ich ihr zu erklären, wenn ich auch an ihrem Blick sah, daß sie mir nicht
glaubte. Plötzlich sprang Pedro von der Weinstaude herunter, streckte sich und stieß schrille, lang
gestreckte Töne in den Morgen. Darauf sprang er wie irre geworden im Kreis herum, schlug mit
seinen Armen heftig um sich als befände er sich in einem Kampf auf Leben und Tod, so das Manni,
der schon lange auf der Insel lebte und als Gelegenheitskellner gerade meinen Kaffee brachte,
stehen blieb und sich verwundert nach dem Affen umschaute, bis dieser endlich schreiend und in
die Luft schlagend die Terrasse verließ und zum Strand lief. Sonja schaute mich vorwurfsvoll an.
"Ein Affe halt", erklärte ich mit zuckenden Schultern.
"So seltsam benimmt sich Pedro schon den ganzen Morgen", sagte Manni und setzte sich
seufzend zu uns. "Vielleicht fühlt er sich auch nicht besonders gut."
"Haben sie dich auch in der Nacht mit Alkohol abgefüllt?" fragte ich ihn mit einem ironischen
Unterton. Sonja ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie stierte auf das Schwimmbecken, in dem
sich die Sonne in einer Weise spiegelte, wie ich es in all' den Wochen, die ich nun schon auf der
Insel weilte, nicht gesehen hatte. War es die Farbe des Lichtes oder die Art des Glitzern in dem von
einem sanften Wind gekräuselten Wasser, das mir befremdlich vor kam und ich fast aufgestanden
wäre um zu schauen, was sich im Wasser abspielte?
"Ich habe gestern so gut wie nichts getrunken", erklärte Manni. Daran kann es nicht liegen. Wäre ja
auch etwas ganz neues! Nein, es ist nur so ein blödes Gefühl. Wie Lampenfieber. Ja, wie
Lampenfieber! Idiotisch, was? Ich habe ein Gefühl als stünde ich vor einer Prüfung, oder vor irgend
etwas - etwas Schrecklichem. Seltsam, nicht war?"
"Vielleicht hättest du doch etwas trinken sollen", erklärte ich spöttisch, "dann würdest du auch kein
Lampenfieber vor nichts haben." Manni lachte kurz auf und ich spürte, dass ihm wirklich nicht ganz
wohl war.
Die Stimmen schimpfender Leute drangen plötzlich zur Terrasse herauf und kurz darauf kamen sie
um die Ecke: Tom und Rico, Jessika und Sabine, Marlies, Arthur und Erwin. Sie hatten ihre Laken
und Badesachen bei sich und fluchten über Pedro, der sie am Strand mit Sand und Kieselsteinen
beworfen hatte, einen Höllen Lärm dabei veranstaltete und sich von all' dem nicht abbringen lassen
wollte, so das ans Schlafen nicht mehr zu denken war. Dem Schimpansen war es gelungen
ausnahmslos alle Leute aufzuwecken und von ihren Schlafstätten zu verjagen. Es dauerte auch
nicht lange, bis sich die Terrasse mit immer mehr fluchenden Leuten füllte. Manni war davon geeilt
um sie mit Kaffee und Orangensaft zu versorgen. Sonja stand plötzlich wortlos auf und ging. Sie
hatte zuletzt nur noch auf das Wasser des Schwimmbecken geschaut, und fast wäre ich ihr hinter
her gelaufen um sie zu fragen, ob sie auch diesen seltsamen Schimmer auf dem Wasser
wahrgenommen hätte und wie sie sich ihn erklärte; doch sogleich dachte ich, daß sie auch von mir
nichts hielt. Also blieb ich sitzen und beobachtete den plötzlichen Trubel auf der Terrasse. Auch aus
der Pension und dem kleinen Hotel kamen die Leute, als wären sie verabredet und alle erklärten
sie, dass sie irgendwie nicht mehr schlafen konnten. "Irgendwie" war ein Wort, dass mir auffiel. Bald
jeder verwandte es, "irgendwie konnte ich nicht mehr schlafen, irgendwie fühle ich mich heute
morgen seltsam, irgendwie kommt mir alles eigenartig vor" und ich schaute auf das Wasser des
Beckens, das mir "irgendwie" seltsam das Licht der Sonne spiegelte.
Ich trank meinen Kaffee aus, stand auf und stellte mich an den Rand der Terrasse um auf das Meer
zu schauen. Eigentlich wusste ich nicht warum ich das tat, denn das Meer interessierte mich genau
genommen so wenig wie die Leute.
An diesem Morgen war die Luft besonders klar und obwohl es um die 40 Grad heiß werden würde,
machte der Himmel und die klare Sonne den Eindruck, als befänden wir uns im Gebirge bei
eiskaltem Winterwetter. Ich mochte so klares Licht und eine so durchsichtige, saubere Luft. An
diesem Morgen empfand ich aber bei dem Licht und dem Himmel, der von einem eigenartigen,
transparenten Blau war, ein Gefühl, dass mich plötzlich an dem erinnerte, was Manni gesagt hatte:
eine Art Lampenfieber - oder Furcht, als wenn einem etwas bevorstand, von dem man nicht wusste
was es war, von dem man aber ahnte, dass es nicht gut war.
Ich drehte mich um und schaute zum Schwimmbecken. Tanja war gekommen. Sie stand in einem
Seidentuch gehüllt am Beckenrand. Unweit von ihr schwänzelten die beiden Typen herum, die
schon seit Tagen - bislang vergeblich - versuchten sich an die Schöne ran zu machen. Sie setzten
sich, jeder an einen Tisch für sich, und beobachteten ihre Traumfrau. Es waren knallharte
Konkurrenten die nicht gut aufeinander zu sprechen waren; soviel war bekannt und auch, das Tanja
das Spiel mit den Jungen genoss, die dabei sehr von sich eingenommen waren. Sie flirtete mit
anderen Männern nur um die beiden zu provozieren und die Vermutung ging umher, dass einem
von Beiden bald der Kragen platzen würde und es zu weniger schönen Szenen kommen würde.
Nun ließ sie das Tuch von ihrem Körper sinken. Sie hatte nur einen winzigen Slip an, der kaum
mehr als ein Akzent an ihrem wohl geformten Körper war. Mit einem gekonnten Sprung tauchte sie
kopfüber ins Wasser ein.
Ich verließ die Terrassen und ging hinunter an den Strand. Mich trieb das Bedürfnis nach Ruhe,
zudem war ich müde. Es war inzwischen windstill und über den Bergen flirte ein dunkelblauer
Lichtschimmer, den ich in dieser Klarheit so noch nie gesehen hatte und den ich eine Weile
fasziniert beobachtete.
Von Pedro war weit und breit nichts zu sehen. Nur ein älteres Ehepaar legte sich gerade unter
einen Sonnenschirm, den sie in den Sand gestopft hatten. Sonst befand sich niemand mehr am
Strand, an dem das Meer mit kleinen Wellen plätscherte, als wäre es kein Meer sondern nur ein
kleiner See im Stadtpark. Die Vögel in den Tamarisken zwitscherten verhalten. Das fiel mir nach
einer Weile auf, während der ich auf dem heißen Sand hockte und dösend ins Wasser stierte. Ihnen
wird es zu heiß sein um großartig Lärm zu machen, erklärte ich mir, als plötzlich in die Stille des
brütenden Vormittages das langsam anschwellende Dröhnen eines Außenbordmotors drang. Auf
dem Meer wuchs ein Punkt zu einem kleinen Fischerboot, in dem ich bald den lustigen Mann mit
der Hakennase erkannte. Es war der schmächtige Fischer, der häufig auf den Strand landete und
sich zu den Touristen gesellte, um mit seinem radebrechenden Englisch ein kleinen Schwatz zu
halten. In meinen Augen war er ein Mensch, dem alle Zeit der Welt gehörte, denn noch nie hatte ich
ihn in Eile gesehen. Landete er nicht auf dem Strand sondern fuhr nur vorbei, so dauerte es ewig
bis er hinter der Landzunge am Ende der Bucht verschwunden war, wo er seine Anlegestelle hatte.
Der Bug seines Bootes ragte an diesem Morgen aber in die Höhe, als wollte er in den Himmel
abheben, während das Heck tief im Wasser lag; dabei zog er eine fette Abgasfahne hinter sich her.
Zielstrebig fuhr er weit draußen am Strand vorbei ohne auch nur für einen Augenblick sein Gesicht
vom anvisierten Ziel abzuwenden. Eine Eile, die mich sehr verwunderte und ich schaute ihm nach,
bis mir die Landzunge den Blick nahm. Erst jetzt bemerkte ich den Mond am Himmel und er jagte
mir einen heftigen Schrecken ein. Doch sofort musste ich über mich und meine seltsame Nervosität
lachen. Es war wirklich nichts außergewöhnliches um diese Jahres- wie Tageszeit die schmale
Sichel des abnehmenden Mondes zu sehen.
Es war mir zu heiß geworden um weiter direkt in der Sonne zu hocken. Als ich aufstand um in den
Schatten zu gehen, wurde mir plötzlich für einen winzigen Augenblick schwarz vor Augen. Was war
das, fragte ich mich. Setzte mein Kreislauf aus? Dabei fühlte ich mich keineswegs schwach oder
Übel. Der Schweiß stand mir zwar auf der Stirn, aber sie war warm. Müde, übernächtigt, ja, das war
ich, mehr aber auch nicht. Ich hatte den Eindruck als wäre die Schwärze etwas Äußeres gewesen,
so als hätte jemand das Licht für einen Augenblick ausgeschaltet. Ich schaute mich um, aber was
hätte ich schon entdecken können? Um mich herum war es einfach nur grell und heiß. Das
Ehepaar lag ruhig unter ihrem Sonnenschirm auf dem Bauch und sie schliefen oder dösten.
Vielleicht war die letzte Nacht doch etwas arg gewesen, dachte ich.
Hexe lag hinter einer dicken Wurzel im Schatten und winselte. Sie hatte sich dicht an eine Wurzel
gepresst und ganz flach gemacht, als wollte sie sich verstecken; dabei zitterte sie am ganzen
Körper. Ich hockte mich nieder und streichelte sie. Die Hündin schaute mich mit treuen Augen
ängstlich an und beruhigte sich nur langsam. Nein, mit Alkohol hatte man sie nicht vergiftet. Das
waren keine Symptome dafür. Auch Verletzungen oder Schmerzen waren nicht feststellbar, so das
sich mein Eindruck verstärkte, sie habe vor irgend etwas Angst - ganz fürchterliche Angst. Und
plötzlich hatte ich wieder dieses unangenehme Gefühl, dieses Lampenfieber. Ein kaputter Tag,
dachte ich und legte mich einfach neben die Hündin in den Sand. Ich streichelte sie noch eine
ganze Weile, aber irgendwann übermannte mich die Müdigkeit und ich schlief ein.
Als ich wach wurde fühlte ich mich sehr gut. Ich musste wohl tief geschlafen haben und es dauerte
einige Zeit, in der meine Gedanken ihre eigenen unbelasteten Wege gingen, bis ich plötzlich
wahrnahm, dass mich jemand rief und mir klar wurde, wo ich mich überhaupt befand. Hexe lag
nicht mehr neben mir, sie war verschwunden. Das Meer war nach wie vor glatt und ruhig und der
Strand lag im Fieber der Mittagshitze. Das alte Ehepaar und ihr Sonnenschirm war verschwunden.
Überall an meiner Haut und meiner Kleidung klebte der Sand, ich war völlig durch geschwitzt. Nun
entdeckte ich Vito, wie er schnaufend den Strand entlang stampfte. Er sah mich und rief mir von
weitem zu, das ich auf die Terrasse kommen solle, es sei wichtig. Darauf drehte er um und eilte
davon.
Auf einer Wurzel sitzend streifte ich mir langsam den Sand ab. So ein Blödsinn, dachte ich, was
sollte es an diesem Ort schon Wichtiges geben? Andererseits hatte ich Durst und Hunger, also ging
ich. Doch als ich ein paar Schritte gelaufen war setzte wieder dieses unangenehme Gefühl ein,
schlagartig und heftig, so als erinnerte ich mich an etwas sehr schlimmes. Ich blieb stehen und
schaute zu dem Platz meiner friedlichen Ruhe zurück. Ach was, ich reise ja nicht ab, sagte ich mir
und ging wieder ein paar Schritte, blieb stehen, schaute mich um, schaute auf das Meer und in
diesen klaren, blauen Himmel unter dem ich schon so viele Stunden dösend und tagträumend
verbracht hatte.
Die Musik auf der Terrasse war recht leise. Das fiel mir sofort auf und auch, das nahezu alle
versammelt waren.
Warum man mich geholt hatte, war aber eigentlich schon kein Thema mehr. Viele hatten sich etwas
zu essen bestellt, andere spielten Schach oder Karten oder saßen einfach bei einem Glas Bier
zusammen und unterhielten sich. Im Schwimmbecken drehten das alte Ehepaar gemächlich ihre
Runden.
Vito rief mich an seine Tisch an dem noch Arthur, Rico, Jessika und Sabine saßen. Sie wollten von
mir wissen, ob ich auch diese "Aussetzer" verspürt hätte.
"Aussetzer?" fragte ich.
"Ja, so ein Blitzen", erklärte Rico.
"Ein Dunkel-Blitzen", warf Arthur ein und grinste dabei, als rechne er damit, dass ich ihn für verrückt
erklären würde.
"Lichtweg. Einfach Lichtweg, verstehst du, für den Bruchteil einer Sekunde", sagte Rico.
Mir war, als rase mein Verstand auf der Suche nach einer Erklärung im Leerlauf. Hexe, Pedro, der
Fischer - die Vögel in den Tamarisken - alles bekam plötzlich einen absurden Sinn.
"Wir denken, es liegt am Stoff", sagte Vito. "Du hast doch gestern auch geraucht." Ich nickte.
"Und?"
"Ich hatte auch so ein Dunkel-blitzen. Heute Vormittag am Strand."
"Seht ihr, alle die geraucht haben", rief Arthur. "Das Zeug taugt nichts. Macht uns nur irre."
"Ich denke nicht, dass es am Stoff liegt", sagte ich und schaute zum Schwimmbecken. Die beiden
Alten stiegen gerade aus dem Wasser. Inzwischen stand die Sonne so, dass sie zur Terrasse hin
nicht mehr Beckens glitzern konnte. Das Wasser sah ganz normal aus, wie jeden Tag. Sonja saß
am Nebentisch und hatte ein Buch vor sich liegen. Sie las aber offensichtlich nicht, sondern
lauschte unserem Gespräch. Als ich sie anschaute versenkte sie ihren Blick in das Buch.
"Worauf führst du denn die Aussetzer zurück", fragte mich Arthur.
"Da hat ein Astronaut in seiner Raumstation den Schalter für die Sonne entdeckt und knipst hin und
wieder das Licht aus um Touristen zu erschrecken", warf Rico ein.
"Quatsch!" rief Sabine, "seit doch mal ernst! Bedenkt doch, dass die Kölner und auch andere, die
nicht geraucht haben, die gleichen Erfahrungen gemacht haben wie wir. Also kann es schon eine
andere Ursachen habe?"
"Das Essen, die Gewürze, das Bier oder chemische Stoffe im Meerwasser", sagte Arthur und
lachte. Sabine seufzte.
"Mir ist das gleich. Ich werde jedenfalls nichts mehr rauchen", stellte Jessika fest. "Mir ist das zu
unheimlich. Da können einem ja wer weiß was für Gedanken kommen."
Manni brachte die Pizzas, die von den fünf bestellt worden waren. Ich wünschte guten Appetit und
holte mir ein Bier, mit dem ich mich nahe des Schwimmbeckens setzte. Hier glitzerte die Sonne wie
gewohnt im Wasser.
Sonja beobachtete mich. Als ich zu ihr hinschaute, wich sie für ein paar Sekunden meinem Blick
nicht aus. Zunächst wollte ich lächeln, spürte aber, das ihr Gesicht hart war und ihre Augen fragend.
Tanja zog sich eine Liege an den Beckenrand um sich zu sonnen. Kaum lag sie, näherte sich ihr
einer von den Beiden Verehrern - der mit den lockigen Haaren - mit einem Cocktail. Er reichte ihr
das Glas aber sie wehrte ab. Mehrmals bot er ihr den Cocktail an und suchte sie zu überreden,
aber Tanja wollte nichts trinken. Plötzlich tauchte der dunkelhaarige Verehrer auf und herrschte den
Lockigen an. Ein heftiger Wortwechsel platzte über die Terrasse, der zunehmend Aufmerksamkeit
verursachte. Nur Tanja lag auf ihrer Liege und tat so, als ginge ihr das alles nichts an. Der Lockige
schmiss das Glas dem Nebenbuhler vor die Füße. Auf der Terrasse verstummten schlagartig alle
Gespräche. Der Dunkelhaarige schaute von dem zerschlagenen Glas vor seinen Füßen zum
Lockigen ganz langsam auf und plötzlich stupste er ihn mit der flachen Hand vor die Brust.
Schneller als man schauen konnte, waren die Beiden aneinander geraten, Schläge klatschten,
Tische wurden umgestoßen und als Manni auftauchte und den Beiden zu rief, sie sollten sofort
aufhören, stürzte der Lockige in das Schwimmbecken. Gelächter schallte über die Terrasse. Der
Dunkelhaarige stampfte davon.
Die Beiden hatte die Aufmerksamkeit aller Leute so in Anspruch genommen, das niemand
bemerkte wie es dunkler geworden war. Ich ging zum Rand der Terrasse und schaute zum Himmel
hinauf. Er war klar und keine Wolken waren zu sehen, auch vom Meer war kein Nebel
aufgestiegen. Die Sonne blendete nach wie vor, dennoch war im allgemeinen deutlich weniger
Licht, so als hätte man eine Sonnenbrille auf, die das Licht dämpfte.
Nach und nach kamen immer mehr und schauten sich ungläubig wie verwundert um und alle
rätselten was denn "nun los sei". "Eine Mondfinsternis", meinte Vito, aber das wurde für
ausgeschlossen gehalten. Dennoch ließ die Intensität des Lichtes einfach nach und die
Himmelbläue änderte sich.
Inzwischen waren alle ins Frei gelaufen und schauten zum Himmel hinauf. Alle redeten sie
durcheinander und Worte wie "phantastisch, ist ja unglaublich!" machten die Runde.
Die ersten hatten ihre Videokamera geholt und einige standen mit dem Fotoapparat da und
knipsten drauf los. Zweifelsfrei bot sich uns ein außergewöhnliches Panorama, ein Spiel des
Lichtes wie es nie jemand gesehen hatte.
Die Sonne stand genau dort, wo sie um diese Zeit zu stehen hatte. Aber sie verlor von Minute zu
Minute ihr Licht. Es war aber keine Abenddämmerung, kein rötlicher Schimmer, der die Berge
hinauf kroch. Und es war auch nicht das Licht eines von Wolken getrübten Tages. Es war nach wie
vor das gleißende Licht einer ungetrübten Sonne, nur daß es erkennbar an Kraft verlor. Es wurde
sanfter und sanfter.
Plötzlich schrie Sonja auf. Sie wies mit zitternder Hand auf das Meer hinaus.
Die Leute verstummten. Niemand wollte und niemand konnte glauben was zu sehen war. Zwischen
dem Meer und dem Himmel wuchs ein schwarzer Streifen wie ein breites klaffendes Maul. Und in
diesem Maul funkelte kleine Punkte. Es waren Sterne.
Plötzlich wurde es windig. Die noch immer heiße Luft bewegte sich und es war als wußte sie nicht
wohin. Keiner sagte etwas und niemand fotografierte mehr. Das Meer tat so als geschehe nichts,
die Vögel waren verstummt, die Sonne leuchtete nur noch wie ein besonders heller Mond mit einem
immer kleiner werdenden Hof aus blauem Himmel. Wir sahen die Sonne und die Sterne zur
gleichen Zeit.
Inzwischen ist es wieder Nacht - von der Uhrzeit her. Das Meer brandet heftig an den Strand, wie
im Herbst oder im Winter. Wir sitzen mit Pullovern und Jacken auf der Terrasse, weil es deutlich
kühler geworden ist. Wir haben entschlossen keinen Alkohol mehr auszugeben und wir versuchen
Stunde um Stunde mit unseren Angehörigen oder mit dem Festland Verbindung aufzunehmen.
Aber das Telefon funktioniert genauso wenig wie das Radio oder das Satellitenfernsehen. Die
Fähren sind ausgeblieben. Wir konnten gerade noch erfahren, dass es weltweit zu unvorstellbaren
Reaktionen gekommen war.
Bald wird es wieder Tag, der Uhrzeit nach. Die Sonne zieht ihre Bahn und man kann sie dabei
beobachten. Denn dort wo sie steht sind keine Sterne zu sehen und ein schwarzer Fleck zieht über
dem Himmel, aus dem hin und wieder ein dunkelroter Schimmer bleckte. Es wird dann sogar etwas
wärmer.
(c) Klaus Dieter Schley
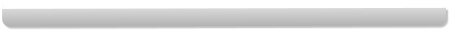
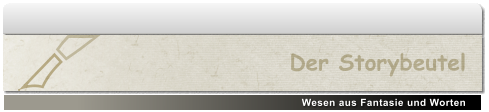
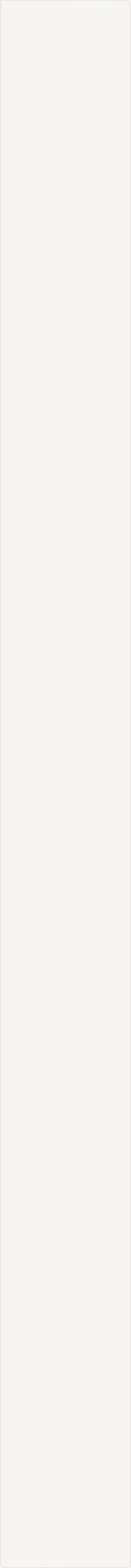
So eine Art Dunkelblitzen
Es war keine Lähmung, die uns daran hinderte,
einander in die Arme zu nehmen. Es war die nackte
Angst einen Menschen wirklich zu spüren, seine Haut
und seine Wärme zu fühlen und durch seinen Nähe
gleich wie durch sein Zittern zu wissen, dass man
nicht träumte. Als ich dann plötzlich Tanja, die nur
einen winzigen Slip an hatte und am Rand des
Schwimmbecken gelegen war, niederknien sah und
beten - wie ein kleines Mädchen bei der
Erstkommunion, war ich kurz davor in brüllendes
Lachen auszubrechen, wenn ich nicht zugleich das
Gefühl gehabt hätte, als wäre mir mein Bauch
aufgeschlitzt worden und ich nun vergeblich versuchte
meine heraus drängenden Gedärme nicht zu
verlieren, so als könne ich dadurch dem
unausweichlichen Tod entkommen, den ich schon in
meinen Händen hielt.
Wir hatten in der Nacht reichlich getrunken und geraucht, wir hatten
gelacht und getanzt und eine Menge Blödsinn geredet, und zum Schluss
haben wir die Party mit einem Bad im Meer unter einem funkelndem
Sternenhimmel abgeschlossen. Da die Nächte auf der kleinen,
weltabgewandten Insel zu dieser Jahreszeit besonders warm waren,
legten sich nach dem Baden viele - nur in ein Laken gewickelt - an den
Strand und schliefen einem neuen Tag entgegen.
Weil ich nicht darauf geachtet hatte und etwas Abseits der Tamarisken
lagerte, wurde ich schon bald von den ersten brennenden
Sonnenstrahlen geweckt, kaum dass die Sonnen über die Berge jenseits
der Bucht gekrochen war. Ich stand auf, badete im Meer und ging zur
Terrasse des Restaurants, um einen Kaffee zu trinken.
Um diese Zeit hatte ich eigentlich erwartet der erste Gast zu sein. Doch
Sonja saß schon an einem Tisch nahe des Schwimmbecken und hatte
vor sich eine Karaffe mit frisch gepresstem Orangensaft stehen. Ich
fragte sie, ob ich mich zu ihr setzen dürfe und sie nickte. Sonja war
bekannt als eine etwas launige Frau, zu der niemand so recht Zugang
fand. Sie zog es vor mit dicken Büchern in eine Ecke zu sitzen und vor
allem ging sie früh schlafen, stand dafür aber zeitig auf.
Als ich einen Augenblick gesessen hatte und nach einem Thema suchte,
über das ich mich mit ihr unterhalten könnte, entdeckte ich Pedro, der
von den überhängenden Weinstauden im hinteren Teil der Terrasse mit
dem Kopf nach unten baumelte und dabei einen seltsam apathischen
Eindruck machte. Sonja schaute mich plötzlich scharf an, als sie
bemerkte, daß ich zu Pedro schaute.
"Findest du das richtig den Tieren Alkohol zu geben", blaffte sie mich an?
Ich schüttelte meinen Kopf weil ich nicht wusste, was sie meinte.
"Du warst doch bestimmt letzte Nacht auch hier oben, als sie Pedro mit
Alkohol getränkten Bananen und Honigmelonen gefüttert haben." Sie
wies zum Schimpansen hinüber. "Ich habe das schon einmal beobachtet
und ich muss sagen, ich finde das fies."
Noch ehe ich etwas antworten konnte fuhr sie fort.
"Hexe habt ihr auch alkoholisiert! So winselnd habe ich die arme Hündin
noch nie erlebt. Sie mochte sich nicht einmal von mir streicheln lassen
und ist jaulend davongelaufen!"
"Und du glaubst, das kommt vom Alkohol der ihnen von irgend jemanden
verabreicht wurde?"
"Ja sicher! Woher sonst?"
"Ich habe natürlich nicht alles gesehen, was letzte Nacht hier geschehen
ist, aber glaube mir, ich habe niemanden beobachtet, der die Tiere
gefüttert hat. Ich habe Pedro und Hexe nicht einmal hier oben gesehen",
versuchte ich ihr zu erklären, wenn ich auch an ihrem Blick sah, daß sie
mir nicht glaubte. Plötzlich sprang Pedro von der Weinstaude herunter,
streckte sich und stieß schrille, lang gestreckte Töne in den Morgen.
Darauf sprang er wie irre geworden im Kreis herum, schlug mit seinen
Armen heftig um sich als befände er sich in einem Kampf auf Leben und
Tod, so das Manni, der schon lange auf der Insel lebte und als
Gelegenheitskellner gerade meinen Kaffee brachte, stehen blieb und sich
verwundert nach dem Affen umschaute, bis dieser endlich schreiend und
in die Luft schlagend die Terrasse verließ und zum Strand lief. Sonja
schaute mich vorwurfsvoll an.
"Ein Affe halt", erklärte ich mit zuckenden Schultern.
"So seltsam benimmt sich Pedro schon den ganzen Morgen", sagte
Manni und setzte sich seufzend zu uns. "Vielleicht fühlt er sich auch nicht
besonders gut."
"Haben sie dich auch in der Nacht mit Alkohol abgefüllt?" fragte ich ihn
mit einem ironischen Unterton. Sonja ließ sich davon nicht beeindrucken.
Sie stierte auf das Schwimmbecken, in dem sich die Sonne in einer
Weise spiegelte, wie ich es in all' den Wochen, die ich nun schon auf der
Insel weilte, nicht gesehen hatte. War es die Farbe des Lichtes oder die
Art des Glitzern in dem von einem sanften Wind gekräuselten Wasser,
das mir befremdlich vor kam und ich fast aufgestanden wäre um zu
schauen, was sich im Wasser abspielte?
"Ich habe gestern so gut wie nichts getrunken", erklärte Manni. Daran
kann es nicht liegen. Wäre ja auch etwas ganz neues! Nein, es ist nur so
ein blödes Gefühl. Wie Lampenfieber. Ja, wie Lampenfieber! Idiotisch,
was? Ich habe ein Gefühl als stünde ich vor einer Prüfung, oder vor
irgend etwas - etwas Schrecklichem. Seltsam, nicht war?"
"Vielleicht hättest du doch etwas trinken sollen", erklärte ich spöttisch,
"dann würdest du auch kein Lampenfieber vor nichts haben." Manni
lachte kurz auf und ich spürte, dass ihm wirklich nicht ganz wohl war.
Die Stimmen schimpfender Leute drangen plötzlich zur Terrasse herauf
und kurz darauf kamen sie um die Ecke: Tom und Rico, Jessika und
Sabine, Marlies, Arthur und Erwin. Sie hatten ihre Laken und
Badesachen bei sich und fluchten über Pedro, der sie am Strand mit
Sand und Kieselsteinen beworfen hatte, einen Höllen Lärm dabei
veranstaltete und sich von all' dem nicht abbringen lassen wollte, so das
ans Schlafen nicht mehr zu denken war. Dem Schimpansen war es
gelungen ausnahmslos alle Leute aufzuwecken und von ihren
Schlafstätten zu verjagen. Es dauerte auch nicht lange, bis sich die
Terrasse mit immer mehr fluchenden Leuten füllte. Manni war davon
geeilt um sie mit Kaffee und Orangensaft zu versorgen. Sonja stand
plötzlich wortlos auf und ging. Sie hatte zuletzt nur noch auf das Wasser
des Schwimmbecken geschaut, und fast wäre ich ihr hinter her gelaufen
um sie zu fragen, ob sie auch diesen seltsamen Schimmer auf dem
Wasser wahrgenommen hätte und wie sie sich ihn erklärte; doch sogleich
dachte ich, daß sie auch von mir nichts hielt. Also blieb ich sitzen und
beobachtete den plötzlichen Trubel auf der Terrasse. Auch aus der
Pension und dem kleinen Hotel kamen die Leute, als wären sie
verabredet und alle erklärten sie, dass sie irgendwie nicht mehr schlafen
konnten. "Irgendwie" war ein Wort, dass mir auffiel. Bald jeder verwandte
es, "irgendwie konnte ich nicht mehr schlafen, irgendwie fühle ich mich
heute morgen seltsam, irgendwie kommt mir alles eigenartig vor" und ich
schaute auf das Wasser des Beckens, das mir "irgendwie" seltsam das
Licht der Sonne spiegelte.
Ich trank meinen Kaffee aus, stand auf und stellte mich an den Rand der
Terrasse um auf das Meer zu schauen. Eigentlich wusste ich nicht warum
ich das tat, denn das Meer interessierte mich genau genommen so wenig
wie die Leute.
An diesem Morgen war die Luft besonders klar und obwohl es um die 40
Grad heiß werden würde, machte der Himmel und die klare Sonne den
Eindruck, als befänden wir uns im Gebirge bei eiskaltem Winterwetter.
Ich mochte so klares Licht und eine so durchsichtige, saubere Luft. An
diesem Morgen empfand ich aber bei dem Licht und dem Himmel, der
von einem eigenartigen, transparenten Blau war, ein Gefühl, dass mich
plötzlich an dem erinnerte, was Manni gesagt hatte: eine Art
Lampenfieber - oder Furcht, als wenn einem etwas bevorstand, von dem
man nicht wusste was es war, von dem man aber ahnte, dass es nicht
gut war.
Ich drehte mich um und schaute zum Schwimmbecken. Tanja war
gekommen. Sie stand in einem Seidentuch gehüllt am Beckenrand.
Unweit von ihr schwänzelten die beiden Typen herum, die schon seit
Tagen - bislang vergeblich - versuchten sich an die Schöne ran zu
machen. Sie setzten sich, jeder an einen Tisch für sich, und
beobachteten ihre Traumfrau. Es waren knallharte Konkurrenten die nicht
gut aufeinander zu sprechen waren; soviel war bekannt und auch, das
Tanja das Spiel mit den Jungen genoss, die dabei sehr von sich
eingenommen waren. Sie flirtete mit anderen Männern nur um die beiden
zu provozieren und die Vermutung ging umher, dass einem von Beiden
bald der Kragen platzen würde und es zu weniger schönen Szenen
kommen würde. Nun ließ sie das Tuch von ihrem Körper sinken. Sie
hatte nur einen winzigen Slip an, der kaum mehr als ein Akzent an ihrem
wohl geformten Körper war. Mit einem gekonnten Sprung tauchte sie
kopfüber ins Wasser ein.
Ich verließ die Terrassen und ging hinunter an den Strand. Mich trieb das
Bedürfnis nach Ruhe, zudem war ich müde. Es war inzwischen windstill
und über den Bergen flirte ein dunkelblauer Lichtschimmer, den ich in
dieser Klarheit so noch nie gesehen hatte und den ich eine Weile
fasziniert beobachtete.
Von Pedro war weit und breit nichts zu sehen. Nur ein älteres Ehepaar
legte sich gerade unter einen Sonnenschirm, den sie in den Sand
gestopft hatten. Sonst befand sich niemand mehr am Strand, an dem das
Meer mit kleinen Wellen plätscherte, als wäre es kein Meer sondern nur
ein kleiner See im Stadtpark. Die Vögel in den Tamarisken zwitscherten
verhalten. Das fiel mir nach einer Weile auf, während der ich auf dem
heißen Sand hockte und dösend ins Wasser stierte. Ihnen wird es zu
heiß sein um großartig Lärm zu machen, erklärte ich mir, als plötzlich in
die Stille des brütenden Vormittages das langsam anschwellende
Dröhnen eines Außenbordmotors drang. Auf dem Meer wuchs ein Punkt
zu einem kleinen Fischerboot, in dem ich bald den lustigen Mann mit der
Hakennase erkannte. Es war der schmächtige Fischer, der häufig auf
den Strand landete und sich zu den Touristen gesellte, um mit seinem
radebrechenden Englisch ein kleinen Schwatz zu halten. In meinen
Augen war er ein Mensch, dem alle Zeit der Welt gehörte, denn noch nie
hatte ich ihn in Eile gesehen. Landete er nicht auf dem Strand sondern
fuhr nur vorbei, so dauerte es ewig bis er hinter der Landzunge am Ende
der Bucht verschwunden war, wo er seine Anlegestelle hatte.
Der Bug seines Bootes ragte an diesem Morgen aber in die Höhe, als
wollte er in den Himmel abheben, während das Heck tief im Wasser lag;
dabei zog er eine fette Abgasfahne hinter sich her. Zielstrebig fuhr er weit
draußen am Strand vorbei ohne auch nur für einen Augenblick sein
Gesicht vom anvisierten Ziel abzuwenden. Eine Eile, die mich sehr
verwunderte und ich schaute ihm nach, bis mir die Landzunge den Blick
nahm. Erst jetzt bemerkte ich den Mond am Himmel und er jagte mir
einen heftigen Schrecken ein. Doch sofort musste ich über mich und
meine seltsame Nervosität lachen. Es war wirklich nichts
außergewöhnliches um diese Jahres- wie Tageszeit die schmale Sichel
des abnehmenden Mondes zu sehen.
Es war mir zu heiß geworden um weiter direkt in der Sonne zu hocken.
Als ich aufstand um in den Schatten zu gehen, wurde mir plötzlich für
einen winzigen Augenblick schwarz vor Augen. Was war das, fragte ich
mich. Setzte mein Kreislauf aus? Dabei fühlte ich mich keineswegs
schwach oder Übel. Der Schweiß stand mir zwar auf der Stirn, aber sie
war warm. Müde, übernächtigt, ja, das war ich, mehr aber auch nicht. Ich
hatte den Eindruck als wäre die Schwärze etwas Äußeres gewesen, so
als hätte jemand das Licht für einen Augenblick ausgeschaltet. Ich
schaute mich um, aber was hätte ich schon entdecken können? Um mich
herum war es einfach nur grell und heiß. Das Ehepaar lag ruhig unter
ihrem Sonnenschirm auf dem Bauch und sie schliefen oder dösten.
Vielleicht war die letzte Nacht doch etwas arg gewesen, dachte ich.
Hexe lag hinter einer dicken Wurzel im Schatten und winselte. Sie hatte
sich dicht an eine Wurzel gepresst und ganz flach gemacht, als wollte sie
sich verstecken; dabei zitterte sie am ganzen Körper. Ich hockte mich
nieder und streichelte sie. Die Hündin schaute mich mit treuen Augen
ängstlich an und beruhigte sich nur langsam. Nein, mit Alkohol hatte man
sie nicht vergiftet. Das waren keine Symptome dafür. Auch Verletzungen
oder Schmerzen waren nicht feststellbar, so das sich mein Eindruck
verstärkte, sie habe vor irgend etwas Angst - ganz fürchterliche Angst.
Und plötzlich hatte ich wieder dieses unangenehme Gefühl, dieses
Lampenfieber. Ein kaputter Tag, dachte ich und legte mich einfach neben
die Hündin in den Sand. Ich streichelte sie noch eine ganze Weile, aber
irgendwann übermannte mich die Müdigkeit und ich schlief ein.
Als ich wach wurde fühlte ich mich sehr gut. Ich musste wohl tief
geschlafen haben und es dauerte einige Zeit, in der meine Gedanken
ihre eigenen unbelasteten Wege gingen, bis ich plötzlich wahrnahm,
dass mich jemand rief und mir klar wurde, wo ich mich überhaupt befand.
Hexe lag nicht mehr neben mir, sie war verschwunden. Das Meer war
nach wie vor glatt und ruhig und der Strand lag im Fieber der
Mittagshitze. Das alte Ehepaar und ihr Sonnenschirm war verschwunden.
Überall an meiner Haut und meiner Kleidung klebte der Sand, ich war
völlig durch geschwitzt. Nun entdeckte ich Vito, wie er schnaufend den
Strand entlang stampfte. Er sah mich und rief mir von weitem zu, das ich
auf die Terrasse kommen solle, es sei wichtig. Darauf drehte er um und
eilte davon.
Auf einer Wurzel sitzend streifte ich mir langsam den Sand ab. So ein
Blödsinn, dachte ich, was sollte es an diesem Ort schon Wichtiges
geben? Andererseits hatte ich Durst und Hunger, also ging ich. Doch als
ich ein paar Schritte gelaufen war setzte wieder dieses unangenehme
Gefühl ein, schlagartig und heftig, so als erinnerte ich mich an etwas sehr
schlimmes. Ich blieb stehen und schaute zu dem Platz meiner friedlichen
Ruhe zurück. Ach was, ich reise ja nicht ab, sagte ich mir und ging
wieder ein paar Schritte, blieb stehen, schaute mich um, schaute auf das
Meer und in diesen klaren, blauen Himmel unter dem ich schon so viele
Stunden dösend und tagträumend verbracht hatte.
Die Musik auf der Terrasse war recht leise. Das fiel mir sofort auf und
auch, das nahezu alle versammelt waren.
Warum man mich geholt hatte, war aber eigentlich schon kein Thema
mehr. Viele hatten sich etwas zu essen bestellt, andere spielten Schach
oder Karten oder saßen einfach bei einem Glas Bier zusammen und
unterhielten sich. Im Schwimmbecken drehten das alte Ehepaar
gemächlich ihre Runden.
Vito rief mich an seine Tisch an dem noch Arthur, Rico, Jessika und
Sabine saßen. Sie wollten von mir wissen, ob ich auch diese "Aussetzer"
verspürt hätte.
"Aussetzer?" fragte ich.
"Ja, so ein Blitzen", erklärte Rico.
"Ein Dunkel-Blitzen", warf Arthur ein und grinste dabei, als rechne er
damit, dass ich ihn für verrückt erklären würde.
"Lichtweg. Einfach Lichtweg, verstehst du, für den Bruchteil einer
Sekunde", sagte Rico.
Mir war, als rase mein Verstand auf der Suche nach einer Erklärung im
Leerlauf. Hexe, Pedro, der Fischer - die Vögel in den Tamarisken - alles
bekam plötzlich einen absurden Sinn.
"Wir denken, es liegt am Stoff", sagte Vito. "Du hast doch gestern auch
geraucht." Ich nickte. "Und?"
"Ich hatte auch so ein Dunkel-blitzen. Heute Vormittag am Strand."
"Seht ihr, alle die geraucht haben", rief Arthur. "Das Zeug taugt nichts.
Macht uns nur irre."
"Ich denke nicht, dass es am Stoff liegt", sagte ich und schaute zum
Schwimmbecken. Die beiden Alten stiegen gerade aus dem Wasser.
Inzwischen stand die Sonne so, dass sie zur Terrasse hin nicht mehr
Beckens glitzern konnte. Das Wasser sah ganz normal aus, wie jeden
Tag. Sonja saß am Nebentisch und hatte ein Buch vor sich liegen. Sie las
aber offensichtlich nicht, sondern lauschte unserem Gespräch. Als ich sie
anschaute versenkte sie ihren Blick in das Buch.
"Worauf führst du denn die Aussetzer zurück", fragte mich Arthur.
"Da hat ein Astronaut in seiner Raumstation den Schalter für die Sonne
entdeckt und knipst hin und wieder das Licht aus um Touristen zu
erschrecken", warf Rico ein.
"Quatsch!" rief Sabine, "seit doch mal ernst! Bedenkt doch, dass die
Kölner und auch andere, die nicht geraucht haben, die gleichen
Erfahrungen gemacht haben wie wir. Also kann es schon eine andere
Ursachen habe?"
"Das Essen, die Gewürze, das Bier oder chemische Stoffe im
Meerwasser", sagte Arthur und lachte. Sabine seufzte.
"Mir ist das gleich. Ich werde jedenfalls nichts mehr rauchen", stellte
Jessika fest. "Mir ist das zu unheimlich. Da können einem ja wer weiß
was für Gedanken kommen."
Manni brachte die Pizzas, die von den fünf bestellt worden waren. Ich
wünschte guten Appetit und holte mir ein Bier, mit dem ich mich nahe des
Schwimmbeckens setzte. Hier glitzerte die Sonne wie gewohnt im
Wasser.
Sonja beobachtete mich. Als ich zu ihr hinschaute, wich sie für ein paar
Sekunden meinem Blick nicht aus. Zunächst wollte ich lächeln, spürte
aber, das ihr Gesicht hart war und ihre Augen fragend.
Tanja zog sich eine Liege an den Beckenrand um sich zu sonnen. Kaum
lag sie, näherte sich ihr einer von den Beiden Verehrern - der mit den
lockigen Haaren - mit einem Cocktail. Er reichte ihr das Glas aber sie
wehrte ab. Mehrmals bot er ihr den Cocktail an und suchte sie zu
überreden, aber Tanja wollte nichts trinken. Plötzlich tauchte der
dunkelhaarige Verehrer auf und herrschte den Lockigen an. Ein heftiger
Wortwechsel platzte über die Terrasse, der zunehmend Aufmerksamkeit
verursachte. Nur Tanja lag auf ihrer Liege und tat so, als ginge ihr das
alles nichts an. Der Lockige schmiss das Glas dem Nebenbuhler vor die
Füße. Auf der Terrasse verstummten schlagartig alle Gespräche. Der
Dunkelhaarige schaute von dem zerschlagenen Glas vor seinen Füßen
zum Lockigen ganz langsam auf und plötzlich stupste er ihn mit der
flachen Hand vor die Brust. Schneller als man schauen konnte, waren die
Beiden aneinander geraten, Schläge klatschten, Tische wurden
umgestoßen und als Manni auftauchte und den Beiden zu rief, sie sollten
sofort aufhören, stürzte der Lockige in das Schwimmbecken. Gelächter
schallte über die Terrasse. Der Dunkelhaarige stampfte davon.
Die Beiden hatte die Aufmerksamkeit aller Leute so in Anspruch
genommen, das niemand bemerkte wie es dunkler geworden war. Ich
ging zum Rand der Terrasse und schaute zum Himmel hinauf. Er war klar
und keine Wolken waren zu sehen, auch vom Meer war kein Nebel
aufgestiegen. Die Sonne blendete nach wie vor, dennoch war im
allgemeinen deutlich weniger Licht, so als hätte man eine Sonnenbrille
auf, die das Licht dämpfte.
Nach und nach kamen immer mehr und schauten sich ungläubig wie
verwundert um und alle rätselten was denn "nun los sei". "Eine
Mondfinsternis", meinte Vito, aber das wurde für ausgeschlossen
gehalten. Dennoch ließ die Intensität des Lichtes einfach nach und die
Himmelbläue änderte sich.
Inzwischen waren alle ins Frei gelaufen und schauten zum Himmel
hinauf. Alle redeten sie durcheinander und Worte wie "phantastisch, ist ja
unglaublich!" machten die Runde.
Die ersten hatten ihre Videokamera geholt und einige standen mit dem
Fotoapparat da und knipsten drauf los. Zweifelsfrei bot sich uns ein
außergewöhnliches Panorama, ein Spiel des Lichtes wie es nie jemand
gesehen hatte.
Die Sonne stand genau dort, wo sie um diese Zeit zu stehen hatte. Aber
sie verlor von Minute zu Minute ihr Licht. Es war aber keine
Abenddämmerung, kein rötlicher Schimmer, der die Berge hinauf kroch.
Und es war auch nicht das Licht eines von Wolken getrübten Tages. Es
war nach wie vor das gleißende Licht einer ungetrübten Sonne, nur daß
es erkennbar an Kraft verlor. Es wurde sanfter und sanfter.
Plötzlich schrie Sonja auf. Sie wies mit zitternder Hand auf das Meer
hinaus.
Die Leute verstummten. Niemand wollte und niemand konnte glauben
was zu sehen war. Zwischen dem Meer und dem Himmel wuchs ein
schwarzer Streifen wie ein breites klaffendes Maul. Und in diesem Maul
funkelte kleine Punkte. Es waren Sterne.
Plötzlich wurde es windig. Die noch immer heiße Luft bewegte sich und
es war als wußte sie nicht wohin. Keiner sagte etwas und niemand
fotografierte mehr. Das Meer tat so als geschehe nichts, die Vögel waren
verstummt, die Sonne leuchtete nur noch wie ein besonders heller Mond
mit einem immer kleiner werdenden Hof aus blauem Himmel. Wir sahen
die Sonne und die Sterne zur gleichen Zeit.
Inzwischen ist es wieder Nacht - von der Uhrzeit her. Das Meer brandet
heftig an den Strand, wie im Herbst oder im Winter. Wir sitzen mit
Pullovern und Jacken auf der Terrasse, weil es deutlich kühler geworden
ist. Wir haben entschlossen keinen Alkohol mehr auszugeben und wir
versuchen Stunde um Stunde mit unseren Angehörigen oder mit dem
Festland Verbindung aufzunehmen. Aber das Telefon funktioniert
genauso wenig wie das Radio oder das Satellitenfernsehen. Die Fähren
sind ausgeblieben. Wir konnten gerade noch erfahren, dass es weltweit
zu unvorstellbaren Reaktionen
gekommen war.
Bald wird es wieder Tag, der
Uhrzeit nach. Die Sonne zieht ihre
Bahn und man kann sie dabei
beobachten. Denn dort wo sie
steht sind keine Sterne zu sehen
und ein schwarzer Fleck zieht
über dem Himmel, aus dem hin
und wieder ein dunkelroter
Schimmer bleckte. Es wird dann
sogar etwas wärmer.
(c) Klaus Dieter Schley