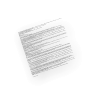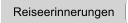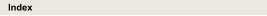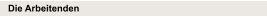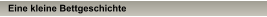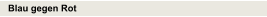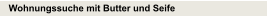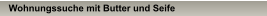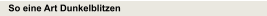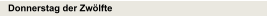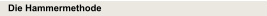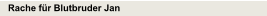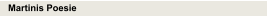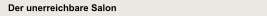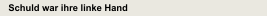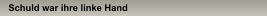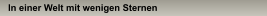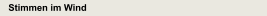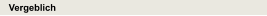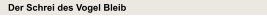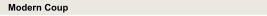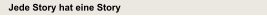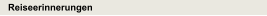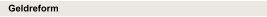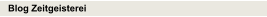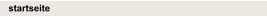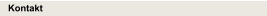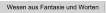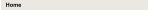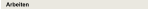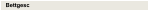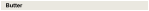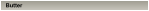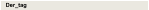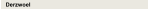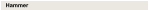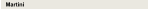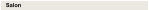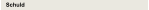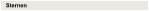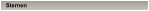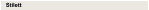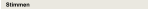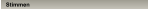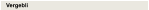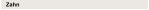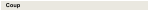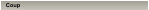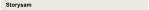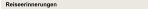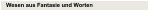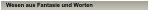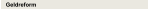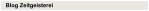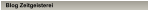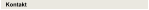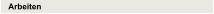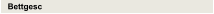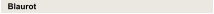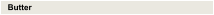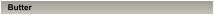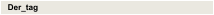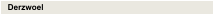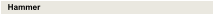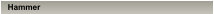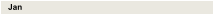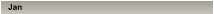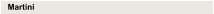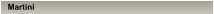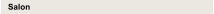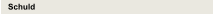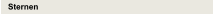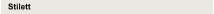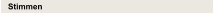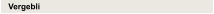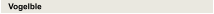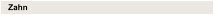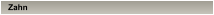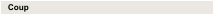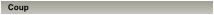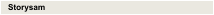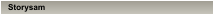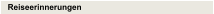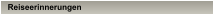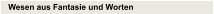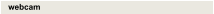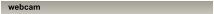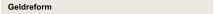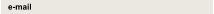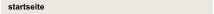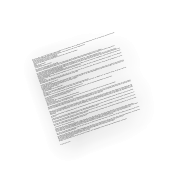


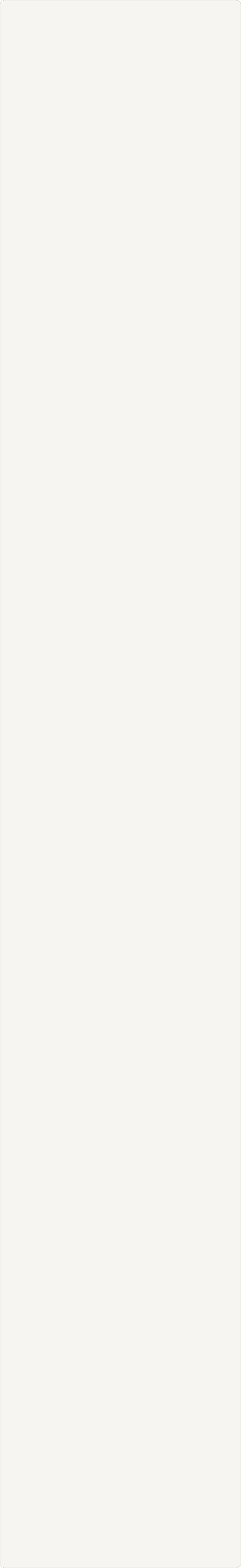
Der unerreichbare Salon
In den Baumkronen zauste der Herbstwind. Mächtige Wolken türmten sich am Himmel und kurze
windgepeitschte Regenschauer rauschten durch die Äste. Dann und wann brach die Sonne
zwischen den Wolken hindurch. Sogleich leuchtete der verwilderte Park. Bunt und freundlich lag er
da, für Augenblicke wie verzaubert im wässrigen Licht. Bis eine schwarze Wolke den Schein
verjagte und faulende Düsterkeit sich über den Wald und das alte Haus legte.
Robert schlich an den Wänden des Gemäuers entlang. Mit der linken Hand stützte er sich an dem
rauen Stein, mit der anderen strich er sein dünnes, windzerzaustes Haar aus dem Gesicht. Müde
und erschöpft war er von der Nacht, die er bald kauernd, bald liegend in den klammen Räumen des
alten Hauses verbracht hatte, bei Marcel, seinem toten Bruder.
Aus einem Loch in der Dachrinne pladderte ein faseriger Wasserstrahl auf die glitschigen Platten
der Terrasse. Robert schlürfte weiter, bis unter das Fenster des weißen Salon. Dort blieb er stehen
und schaute hinauf. Eine Seite des verwitterten Fensterladens schwankte quietschend im Wind. Er
schloss die Augen und schaute, ja hörte weit zurück. Stimmen erklangen; helle freundliche Rufe,
das muntere Geplätscher eines Springbrunnens. Und Musik. Er hörte sie spielen, deutlich und laut.
Mama saß an ihrem Flügel und spielte. Sie spielte schon den ganzen, langen Nachmittag. Ihre
Musik erfüllte das Haus, erfüllte den Garten und den Park, erfüllte die Herzen der Menschen. Sie
war so eifrig, so beflissentlich wie die Vögel in den Bäumen. Ihre Musik strömte aus den hohen
geöffneten Fenstern des weißen Salons, ergoss sich in den licht durchfluteten Park, ließ die
Schmetterlinge tanzen, vermischte sich mit dem Rauschen des Windes in den Bäumen. Wie gerne
hätte auch er ihre Musik geliebt.
"Was machst du da?" zischte die Haushälterin. Sie wedelte mit ihren Händen, gleich als sie um die
Ecke kam und ihn sah.
"Ihr wisst doch, eure Mutter braucht Ruhe. Sie will ungestört sein. Geh, geh weg, geh hinüber zum
Pavillon. Da ist auch dein Bruder."
Marcel? Ja, dort hinten im gleißenden Sonnenlicht läuft Marcel. Hält er einen Ball in der Hand?
Nein, er läuft den tanzenden Schmetterlingen nach. Er will sie fangen und Mama schenken.
"Aber Marcel, du liegst doch im Keller. Mit einem blutenden Kopf. Das kommt davon. Warum
wolltest du auch in den Salon."
Robert ging hinüber zum Pavillon.
"Und verhaltet euch ruhig", zischt ihm die Haushälterin nach.
Das helle Holz war warm. Er hockt sich auf den Boden und legte seinen Kopf an einen Balken der
Brüstung. Auch hier war Mamas Musik zu hören. Sie spielte das Venezianische Gondellied von
Felix Mendelssohn Bartholdy. Oft, ja wie oft hatte er es schon gehört. Wie fein sie die Töne traf. Er
spürte, wie sie ihr ganzes Gefühl in die Musik legte, ihre ganze Liebe. Alle spürten es, die Insekten,
die Vögel, die hohen Bäume, der Wind. Selbst die kleinen weißen Wolken, die bedächtig über das
rote, im Sonnenlicht leuchtende Dach des alten Hauses zogen.
Robert wog seinen Körper in dem Rhythmus der Natur. Wie unbekümmert krabbelten die Ameisen
über die Bohlen des Pavillon, und wie schwer war sein Herz.
Er schaute hinüber zum Haus.
"Marcel!" Überrascht richtete er sich auf.
"Was machst du dort oben?" Sein Bruder stand am Fenster des Salon. "Mama spielt doch. Sie will
nicht gestört werden!"
Marcel schaute hinunter in den Park. Jetzt trafen sich ihre Blicke. Da trat Marcel zurück, schloss
den Fensterflügel und war verschwunden. Die Musik klang aus.
Bebend stand Robert im Pavillon und stützte sich benommen am modrigen Holz. Er fror. Die
Fensterläden des Salon wurden unschlüssig vom Wind hin und her getrieben. Ein heller
Sonnenschein lief über das bunte Laub der Bäume und über das matte Gras; lief zu auf das nasse
graue Haus, leckte die Wände empor und blitzte auf im dunklen Fenster des Salon. Da knallte ein
Fensterladen. Es regnete.
Müde schlurfte er zum Haus zurück. Unter der Balustrade des Balkons hatte er gestern Nachmittag
auf Marcel gewartet.
"Du hast den Schlüssel bekommen?"
"Ja, der Mann konnte sich noch gut an Mutter erinnern. Sie war ja damals bekannt, nicht nur in der
Stadt.
'Eine berühmte Pianistin', sagte der Mann."
"Berühmt, ja."
"Auch an uns konnte er sich erinnern."
"So?"
"Ja, wir sollen vorsichtig sein. Das Haus ist baufällig. Es soll abgerissen werden."
"Wie du schon sagtest."
"Deshalb wollte ich es ja auch noch einmal sehen."
Die beiden Brüder gingen hoch zum Portal, dessen schwere Tür zusätzlich mit einem großen
Vorhängeschloss gesichert war. Robert beobachtete seinen Bruder, wie er die Tür aufschloss. Noch
immer hatte Marcel dieses dichte, volle Haar, durch das ihn Mutter oft gekrault hatte, wenn sie
gemeinsam vor dem Kamin saßen oder auf der Terrasse, um der untergehenden Sonne nach
zuschauen. Aber an einigen Stellen zeigten sich graue Strähnen.
"Seltsam", sagte Marcel, als er aufgeschlossen hatte. "An den Herbst hier draußen kann ich mich
nicht erinnern."
Sie schauten zurück in den Wald.
"Wir waren ja auch nur in den Sommermonaten hier. Die andere Zeit waren wir in der Stadt und
Mutter auf Tournee."
"Stimmt. Wo du es jetzt sagst."
Marcel drückte die Tür auf. Muffige Luft empfing sie, als sie die Eingangshalle betraten. Sie
schlenderten über das knarrende Parkett. Robert hatte seinen Mantelkragen hochgeschlagen und
die Hände tief in die Taschen vergraben. Ihm war kalt. Marcel aber öffnete seinen langen weißen
Trenchcoat. Die Gürtelschnalle baumelte locker an der Seite. Er berührte die fleckige Tapete.
"Seit damals, als Mutter das Haus gekündigt hatte, ist es unbewohnt."
"All die Jahre?"
"Ja. Nur die Möbel hatte der Mann im Laufe der Zeit verkauft. Es ist gewissermaßen noch Mutters
Haus."
Marcel wandte sich an seinen Bruder.
"Was ist mit dir? Du bist so seltsam. Fehlt dir etwas?"
"Nein. Mir ist nur kalt."
Durch die verschlossenen Fenster kam nur wenig Tageslicht. An den Wänden, auf dem stumpfen
Parkett und an ihren Mäntel zeichneten sich kleine Lichtflecken der Fensterläden ab.
"Auch ohne Möbel ist alles gut wieder zu erkennen", sagte Robert.
"Stimmt. Ich erinnere mich auch der Einrichtung. Schau, dies ist das Esszimmer." Marcel schritt ein
paar Meter voraus.
"Hier, genau hier hat der ovale Tisch gestanden."
"Und hier, am schmalen Ende war Mutters Platz. Sie saß mit dem Rücken zum Fenster."
"Ja, und du hast dort zu ihrer rechten und ich hier zu ihrer linken Seite gesessen." Marcel lachte.
"Und wenn mittags die Sonne schien, hat sie dich geblendet, schautest du Mutter an. Dann wolltest
du, dass wir den Fensterladen schließen. Und Mutter sagte: 'Hab dich nicht so. Du brauchst mich ja
nicht die ganze Zeit anschauen.' Du aber bestandest darauf, dass die Lade geschlossen wird. Und
dann hattest du diese rhombusförmigen Lichtflecken im Gesicht. Du sahst zum Schießen aus."
Marcel lachte. Robert ging ein paar Schritte zur Wand und drehte sich um. Da lachte Marcel so laut,
dass es durch das Haus hallte, denn auf Roberts Gesicht waren wieder die Lichtflecken. Robert
schaute seinen Bruder mit starrem Gesicht an. Da starb Marcels Lachen.
"Entschuldige bitte."
Sie gingen zurück in die Eingangshalle.
"Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier raus zu fahren und in längst vergangene Zeiten zu
stöbern", sagte Marcel nach einer Weile. Seufzend schaute er die breite Treppe zum Obergeschoss
hinauf. Vor dem Aufgang war eine Holzleiste zwischen der Wand und dem Treppengeländer
befestigt. Robert ging an dem Aufgang vorbei in die dunkle Ecke zur Kellertür. Langsam zog er
seine rechte Hand aus der Manteltasche und legte sie auf die rostende Klinke. Die Tür war
verriegelt.
"Ich sperre dich in den Keller, wenn du nicht hören willst und immer bei der Treppe herumlungerst",
schimpfte die Haushälterin.
"Deine Mutter braucht jetzt Ruhe."
"Wo ist Marcel?" fragte Robert. Die Haushälterin schaute ihn erbost an.
"Hast du schon deine Vokabeln gelernt?"
Robert schüttelte den Kopf.
"Na also, was willst du noch hier. An die Arbeit!"
"Wo ist Marcel?" rief Robert und stampfte mit dem Fuß. Die Haushälterin schaute ihn einen
Augenblick verständnislos an, dann verschwand sie in die Küche.
"Ich war niemals im Keller", sagte Marcel und trat an die Seite seines Bruders.
"Ich habe immer Angst gehabt dort hinunter zugehen."
Auf die starren Gesichter der Brüder standen Schatten. Ein kalter Schauer erfasste Marcel. Nervös
schloss er seinen Trenchcoat und ging eilig in die Mitte der Eingangshalle. Robert trat aus dem
Dunkel der Nische.
"Wenn ich an Mutter denke, sehe ich nur noch ihr vom Schmerz verzerrtes Gesicht", sagte Marcel.
"Die letzten Tage sind mir in Erinnerung, damals, bevor sie starb. Schon seit Jahren sehe ich nichts
anderes mehr. Ich sehe sie nur noch in dem Bett liegen, unter dieser kalkweißen Decke. Sie hatte
zum Schluss gar keine Haare mehr. Und ihre Hände, diese schönen, aber kräftigen Finger. Das
waren doch nur noch Knorpel." Marcel schaute sich um.
"Ich glaubte, wenn ich hier raus fahre, mit dir zusammen, und das Haus noch einmal sähe, würde
mir anderes in Erinnerung kommen. Aber..." Er drehte sich langsam in der dunklen Eingangshalle,
dann wandte er sich der abgesperrten Treppe zu.
"Weißt du, das wir eigentlich nie eine Familie waren?"
Robert nickte.
"Unseren Vater haben wir ja nicht gekannt. Und Mutter? Nur die wenigen Wochen im Sommer, in
den Ferien, wenn wir in diesem Haus wohnten, waren wir zusammen."
Marcel ging hin und her. Plötzlich blieb er stehen.
"Wenn ich die Augen schließe, dann glaube ich, ja dann höre ich sie spielen: Schumann..."
"Ja!" schrie Robert. Marcel schreckte auf und schaute seinen Bruder verwundert an.
"Was ist?"
"Du bist bei ihr oben gewesen!"
"Ich verstehe nicht?"
Robert wehrte ab und vergrub seine Hände wieder in den Manteltaschen.
"Ach nichts. Entschuldige bitte."
Marcel schlenderte bis zur Absperrung der Treppe. Er schaute hoch. Oben, an der weißen Wand
des Flures schwankte der Schatten eines Fensterkreuzes.
"Du meinst, ich war bei Mutter oben, wenn sie im weißen Salon spielte. Als sie nicht gestört sein
wollte und uns fort schickte."
Er schaute zu seinen Bruder hinüber.
"Als sie dich wegschickte."
Robert nickte.
"Du hast ihre Musik nicht gemocht", sagte Marcel. "Sie hatte Angst gehabt."
"Angst?"
"Du bist einmal heimlich in ihrem Salon gewesen. Mutter erzählte es mir. Sie kam herein und du
standest auf der Bank. Du beugtest dich über den Flügel. Was hattest du vor?"
Robert wandte sich ab und ging ein paar Schritte über das knarrende Parkett.
"Du warst eifersüchtig auf ihre Musik", rief ihm Marcel nach.
"Du nicht?"
"Ja, sie hatte viel gespielt. Sehr viel. Sie hatte ihre Musik geliebt, vielleicht mehr als uns. Ich weiß
es nicht. Aber ich habe es gemocht, wie sie spielte. - Weiß du, das in dem Salon nur der Flügel
stand und die schmale Bank, auf der sie saß? Nicht einmal Bilder hingen an der Wand."
"Mag sein", sagte Robert. Marcel legte seine Hände auf die Absperrung und schaute die Treppe
hinauf. Plötzlich zerrte er an der Absperrung.
"Was machst du da?"
Krachend zersplitterte die Leiste.
"Ich will den weißen Salon noch einmal sehen!"
"Die Treppe, sei vorsichtig!"
Langsam stieg Marcel die Stufen hinauf. Der Wind zerrte wütend am Dach. An der Wand pulsierte
der Schatten des Fensterkreuzes. Marcel war schon fast oben, als er sich umschaute und sagte:
"Die knarren nicht einmal."
"Warte, ich komme mit", rief Robert und betrat die erste Stufe. Sofort sprang er zurück. Die Treppe
bebte, krachend verschlang sie Marcel zwischen den berstenden Bohlen. Staub wirbelte auf. Ein
kalter Lufthauch ging durch die Halle.
Robert starrte überrascht auf das Loch, das in der Treppe wie ein Krater klaffte. Dann lief er zur
Kellertür und rüttelte an der Klinke, bis sie abbrach. Hinter der Tür hörte er seinen Bruder stöhnen.
"Warum wolltest du auch in den Salon!"
Er lief zur Treppe zurück. Vorsichtig zog er sich am Geländer hoch bis zu dem dunklen Loch.
Muffige, nasse Luft stieg ihm entgegen. Er zündete sein Feuerzeug und hielt die wild flackernde
Flamme hinab. Nur undeutlich konnte er seinen Bruder auf der untersten Kellerstufe erkennen. Ein
schwankender Balken behinderte die Sicht. Mit der linken Hand packte er den Balken. Marcel
bewegte sich. Einen Augenblick verharrte Robert, dann drückte er vorsichtig den Balken zur Seite.
Da brach er ab. Robert versuchte, ihn zu ergreifen - vergeblich. Ein dumpfer, hohler Schlag hallte
aus dem Keller.
"Marcel!" Im Flackerschein sah Robert das Blut überströmte Gesicht bis ein heller Schmerz seine
Finger durchzuckte und ihm das heiße Feuerzeug aus der Hand schlug. Marcel war im Dunkeln
vergraben.
Robert richtete sich auf und schaute hoch zum Flur. Kaum noch war der Schatten des
Fensterkreuzes zu sehen. Bald würde es draußen dunkel sein. War da nicht Musik? Nein, sicher
der Wind. Er wollte einen Schritt höher gehen, das Loch überschreiten. Aber drohend knackte das
Holz. Langsam zog er sich zurück. Der weiße Salon blieb unerreichbar.
(c) Klaus Dieter Schley
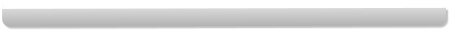
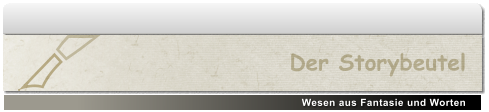
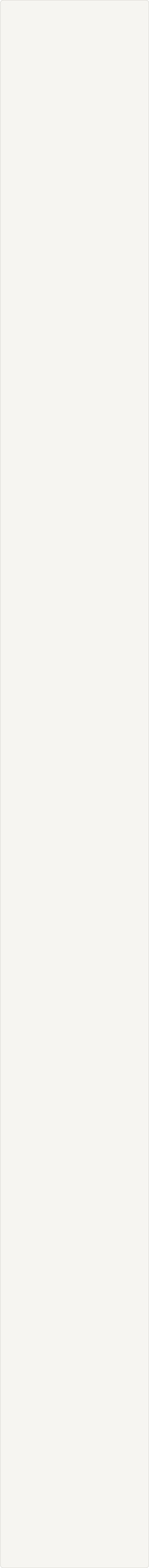
Der unerreichbare Salon
In den Baumkronen zauste der Herbstwind.
Mächtige Wolken türmten sich am Himmel und
kurze windgepeitschte Regenschauer rauschten
durch die Äste. Dann und wann brach die Sonne
zwischen den Wolken hindurch. Sogleich
leuchtete der verwilderte Park. Bunt und
freundlich lag er da, für Augenblicke wie
verzaubert im wässrigen Licht. Bis eine schwarze
Wolke den Schein verjagte und faulende
Düsterkeit sich über den Wald und das alte Haus
legte.
Robert schlich an den Wänden des Gemäuers
entlang. Mit der linken Hand stützte er sich an
dem rauen Stein, mit der anderen strich er sein
dünnes, windzerzaustes Haar aus dem Gesicht.
Müde und erschöpft war er von der Nacht, die er bald kauernd, bald
liegend in den klammen Räumen des alten Hauses verbracht hatte, bei
Marcel, seinem toten Bruder.
Aus einem Loch in der Dachrinne pladderte ein faseriger Wasserstrahl
auf die glitschigen Platten der Terrasse. Robert schlürfte weiter, bis unter
das Fenster des weißen Salon. Dort blieb er stehen und schaute hinauf.
Eine Seite des verwitterten Fensterladens schwankte quietschend im
Wind. Er schloss die Augen und schaute, ja hörte weit zurück. Stimmen
erklangen; helle freundliche Rufe, das muntere Geplätscher eines
Springbrunnens. Und Musik. Er hörte sie spielen, deutlich und laut. Mama
saß an ihrem Flügel und spielte. Sie spielte schon den ganzen, langen
Nachmittag. Ihre Musik erfüllte das Haus, erfüllte den Garten und den
Park, erfüllte die Herzen der Menschen. Sie war so eifrig, so beflissentlich
wie die Vögel in den Bäumen. Ihre Musik strömte aus den hohen
geöffneten Fenstern des weißen Salons, ergoss sich in den licht
durchfluteten Park, ließ die Schmetterlinge tanzen, vermischte sich mit
dem Rauschen des Windes in den Bäumen. Wie gerne hätte auch er ihre
Musik geliebt.
"Was machst du da?" zischte die Haushälterin. Sie wedelte mit ihren
Händen, gleich als sie um die Ecke kam und ihn sah.
"Ihr wisst doch, eure Mutter braucht Ruhe. Sie will ungestört sein. Geh,
geh weg, geh hinüber zum Pavillon. Da ist auch dein Bruder."
Marcel? Ja, dort hinten im gleißenden Sonnenlicht läuft Marcel. Hält er
einen Ball in der Hand? Nein, er läuft den tanzenden Schmetterlingen
nach. Er will sie fangen und Mama schenken.
"Aber Marcel, du liegst doch im Keller. Mit einem blutenden Kopf. Das
kommt davon. Warum wolltest du auch in den Salon."
Robert ging hinüber zum Pavillon.
"Und verhaltet euch ruhig", zischt ihm die Haushälterin nach.
Das helle Holz war warm. Er hockt sich auf den Boden und legte seinen
Kopf an einen Balken der Brüstung. Auch hier war Mamas Musik zu
hören. Sie spielte das Venezianische Gondellied von Felix Mendelssohn
Bartholdy. Oft, ja wie oft hatte er es schon gehört. Wie fein sie die Töne
traf. Er spürte, wie sie ihr ganzes Gefühl in die Musik legte, ihre ganze
Liebe. Alle spürten es, die Insekten, die Vögel, die hohen Bäume, der
Wind. Selbst die kleinen weißen Wolken, die bedächtig über das rote, im
Sonnenlicht leuchtende Dach des alten Hauses zogen.
Robert wog seinen Körper in dem Rhythmus der Natur. Wie
unbekümmert krabbelten die Ameisen über die Bohlen des Pavillon, und
wie schwer war sein Herz.
Er schaute hinüber zum Haus.
"Marcel!" Überrascht richtete er sich auf.
"Was machst du dort oben?" Sein Bruder stand am Fenster des Salon.
"Mama spielt doch. Sie will nicht gestört werden!"
Marcel schaute hinunter in den Park. Jetzt trafen sich ihre Blicke. Da trat
Marcel zurück, schloss den Fensterflügel und war verschwunden. Die
Musik klang aus.
Bebend stand Robert im Pavillon und stützte sich benommen am
modrigen Holz. Er fror. Die Fensterläden des Salon wurden unschlüssig
vom Wind hin und her getrieben. Ein heller Sonnenschein lief über das
bunte Laub der Bäume und über das matte Gras; lief zu auf das nasse
graue Haus, leckte die Wände empor und blitzte auf im dunklen Fenster
des Salon. Da knallte ein Fensterladen. Es regnete.
Müde schlurfte er zum Haus zurück. Unter der Balustrade des Balkons
hatte er gestern Nachmittag auf Marcel gewartet.
"Du hast den Schlüssel bekommen?"
"Ja, der Mann konnte sich noch gut an Mutter erinnern. Sie war ja damals
bekannt, nicht nur in der Stadt.
'Eine berühmte Pianistin', sagte der Mann."
"Berühmt, ja."
"Auch an uns konnte er sich erinnern."
"So?"
"Ja, wir sollen vorsichtig sein. Das Haus ist baufällig. Es soll abgerissen
werden."
"Wie du schon sagtest."
"Deshalb wollte ich es ja auch noch einmal sehen."
Die beiden Brüder gingen hoch zum Portal, dessen schwere Tür
zusätzlich mit einem großen Vorhängeschloss gesichert war. Robert
beobachtete seinen Bruder, wie er die Tür aufschloss. Noch immer hatte
Marcel dieses dichte, volle Haar, durch das ihn Mutter oft gekrault hatte,
wenn sie gemeinsam vor dem Kamin saßen oder auf der Terrasse, um
der untergehenden Sonne nach zuschauen. Aber an einigen Stellen
zeigten sich graue Strähnen.
"Seltsam", sagte Marcel, als er aufgeschlossen hatte. "An den Herbst hier
draußen kann ich mich nicht erinnern."
Sie schauten zurück in den Wald.
"Wir waren ja auch nur in den Sommermonaten hier. Die andere Zeit
waren wir in der Stadt und Mutter auf Tournee."
"Stimmt. Wo du es jetzt sagst."
Marcel drückte die Tür auf. Muffige Luft empfing sie, als sie die
Eingangshalle betraten. Sie schlenderten über das knarrende Parkett.
Robert hatte seinen Mantelkragen hochgeschlagen und die Hände tief in
die Taschen vergraben. Ihm war kalt. Marcel aber öffnete seinen langen
weißen Trenchcoat. Die Gürtelschnalle baumelte locker an der Seite. Er
berührte die fleckige Tapete.
"Seit damals, als Mutter das Haus gekündigt hatte, ist es unbewohnt."
"All die Jahre?"
"Ja. Nur die Möbel hatte der Mann im Laufe der Zeit verkauft. Es ist
gewissermaßen noch Mutters Haus."
Marcel wandte sich an seinen Bruder.
"Was ist mit dir? Du bist so seltsam. Fehlt dir etwas?"
"Nein. Mir ist nur kalt."
Durch die verschlossenen Fenster kam nur wenig Tageslicht. An den
Wänden, auf dem stumpfen Parkett und an ihren Mäntel zeichneten sich
kleine Lichtflecken der Fensterläden ab.
"Auch ohne Möbel ist alles gut wieder zu erkennen", sagte Robert.
"Stimmt. Ich erinnere mich auch der Einrichtung. Schau, dies ist das
Esszimmer." Marcel schritt ein paar Meter voraus.
"Hier, genau hier hat der ovale Tisch gestanden."
"Und hier, am schmalen Ende war Mutters Platz. Sie saß mit dem Rücken
zum Fenster."
"Ja, und du hast dort zu ihrer rechten und ich hier zu ihrer linken Seite
gesessen." Marcel lachte.
"Und wenn mittags die Sonne schien, hat sie dich geblendet, schautest
du Mutter an. Dann wolltest du, dass wir den Fensterladen schließen.
Und Mutter sagte: 'Hab dich nicht so. Du brauchst mich ja nicht die ganze
Zeit anschauen.' Du aber bestandest darauf, dass die Lade geschlossen
wird. Und dann hattest du diese rhombusförmigen Lichtflecken im
Gesicht. Du sahst zum Schießen aus." Marcel lachte. Robert ging ein
paar Schritte zur Wand und drehte sich um. Da lachte Marcel so laut,
dass es durch das Haus hallte, denn auf Roberts Gesicht waren wieder
die Lichtflecken. Robert schaute seinen Bruder mit starrem Gesicht an.
Da starb Marcels Lachen.
"Entschuldige bitte."
Sie gingen zurück in die Eingangshalle.
"Vielleicht war es doch keine so gute Idee, hier raus zu fahren und in
längst vergangene Zeiten zu stöbern", sagte Marcel nach einer Weile.
Seufzend schaute er die breite Treppe zum Obergeschoss hinauf. Vor
dem Aufgang war eine Holzleiste zwischen der Wand und dem
Treppengeländer befestigt. Robert ging an dem Aufgang vorbei in die
dunkle Ecke zur Kellertür. Langsam zog er seine rechte Hand aus der
Manteltasche und legte sie auf die rostende Klinke. Die Tür war verriegelt.
"Ich sperre dich in den Keller, wenn du nicht hören willst und immer bei
der Treppe herumlungerst", schimpfte die Haushälterin.
"Deine Mutter braucht jetzt Ruhe."
"Wo ist Marcel?" fragte Robert. Die Haushälterin schaute ihn erbost an.
"Hast du schon deine Vokabeln gelernt?"
Robert schüttelte den Kopf.
"Na also, was willst du noch hier. An die Arbeit!"
"Wo ist Marcel?" rief Robert und stampfte mit dem Fuß. Die Haushälterin
schaute ihn einen Augenblick verständnislos an, dann verschwand sie in
die Küche.
"Ich war niemals im Keller", sagte Marcel und trat an die Seite seines
Bruders.
"Ich habe immer Angst gehabt dort hinunter zugehen."
Auf die starren Gesichter der Brüder standen Schatten. Ein kalter
Schauer erfasste Marcel. Nervös schloss er seinen Trenchcoat und ging
eilig in die Mitte der Eingangshalle. Robert trat aus dem Dunkel der
Nische.
"Wenn ich an Mutter denke, sehe ich nur noch ihr vom Schmerz
verzerrtes Gesicht", sagte Marcel.
"Die letzten Tage sind mir in Erinnerung, damals, bevor sie starb. Schon
seit Jahren sehe ich nichts anderes mehr. Ich sehe sie nur noch in dem
Bett liegen, unter dieser kalkweißen Decke. Sie hatte zum Schluss gar
keine Haare mehr. Und ihre Hände, diese schönen, aber kräftigen Finger.
Das waren doch nur noch Knorpel." Marcel schaute sich um.
"Ich glaubte, wenn ich hier raus fahre, mit dir zusammen, und das Haus
noch einmal sähe, würde mir anderes in Erinnerung kommen. Aber..." Er
drehte sich langsam in der dunklen Eingangshalle, dann wandte er sich
der abgesperrten Treppe zu.
"Weißt du, das wir eigentlich nie eine Familie waren?"
Robert nickte.
"Unseren Vater haben wir ja nicht gekannt. Und Mutter? Nur die wenigen
Wochen im Sommer, in den Ferien, wenn wir in diesem Haus wohnten,
waren wir zusammen."
Marcel ging hin und her. Plötzlich blieb er stehen.
"Wenn ich die Augen schließe, dann glaube ich, ja dann höre ich sie
spielen: Schumann..."
"Ja!" schrie Robert. Marcel schreckte auf und schaute seinen Bruder
verwundert an.
"Was ist?"
"Du bist bei ihr oben gewesen!"
"Ich verstehe nicht?"
Robert wehrte ab und vergrub seine Hände wieder in den Manteltaschen.
"Ach nichts. Entschuldige bitte."
Marcel schlenderte bis zur Absperrung der Treppe. Er schaute hoch.
Oben, an der weißen Wand des Flures schwankte der Schatten eines
Fensterkreuzes.
"Du meinst, ich war bei Mutter oben, wenn sie im weißen Salon spielte.
Als sie nicht gestört sein wollte und uns fort schickte."
Er schaute zu seinen Bruder hinüber.
"Als sie dich wegschickte."
Robert nickte.
"Du hast ihre Musik nicht gemocht", sagte Marcel. "Sie hatte Angst
gehabt."
"Angst?"
"Du bist einmal heimlich in ihrem Salon gewesen. Mutter erzählte es mir.
Sie kam herein und du standest auf der Bank. Du beugtest dich über den
Flügel. Was hattest du vor?"
Robert wandte sich ab und ging ein paar Schritte über das knarrende
Parkett.
"Du warst eifersüchtig auf ihre Musik", rief ihm Marcel nach.
"Du nicht?"
"Ja, sie hatte viel gespielt. Sehr viel. Sie hatte ihre Musik geliebt, vielleicht
mehr als uns. Ich weiß es nicht. Aber ich habe es gemocht, wie sie
spielte. - Weiß du, das in dem Salon nur der Flügel stand und die
schmale Bank, auf der sie saß? Nicht einmal Bilder hingen an der Wand."
"Mag sein", sagte Robert. Marcel legte seine Hände auf die Absperrung
und schaute die Treppe hinauf. Plötzlich zerrte er an der Absperrung.
"Was machst du da?"
Krachend zersplitterte die Leiste.
"Ich will den weißen Salon noch einmal sehen!"
"Die Treppe, sei vorsichtig!"
Langsam stieg Marcel die Stufen hinauf. Der Wind zerrte wütend am
Dach. An der Wand pulsierte der Schatten des Fensterkreuzes. Marcel
war schon fast oben, als er sich umschaute und sagte: "Die knarren nicht
einmal."
"Warte, ich komme mit", rief Robert und betrat die erste Stufe. Sofort
sprang er zurück. Die Treppe bebte, krachend verschlang sie Marcel
zwischen den berstenden Bohlen. Staub wirbelte auf. Ein kalter Lufthauch
ging durch die Halle.
Robert starrte überrascht auf das Loch, das in der Treppe wie ein Krater
klaffte. Dann lief er zur Kellertür und rüttelte an der Klinke, bis sie
abbrach. Hinter der Tür hörte er seinen Bruder stöhnen.
"Warum wolltest du auch in den Salon!"
Er lief zur Treppe zurück. Vorsichtig zog er sich am Geländer hoch bis zu
dem dunklen Loch. Muffige, nasse Luft stieg ihm entgegen. Er zündete
sein Feuerzeug und hielt die wild flackernde Flamme hinab. Nur
undeutlich konnte er seinen Bruder auf der untersten Kellerstufe
erkennen. Ein schwankender Balken behinderte die Sicht. Mit der linken
Hand packte er den Balken. Marcel bewegte sich. Einen Augenblick
verharrte Robert, dann drückte er vorsichtig den Balken zur Seite. Da
brach er ab. Robert versuchte, ihn zu ergreifen - vergeblich. Ein dumpfer,
hohler Schlag hallte aus dem Keller.
"Marcel!" Im Flackerschein sah Robert
das Blut überströmte Gesicht bis ein
heller Schmerz seine Finger
durchzuckte und ihm das heiße
Feuerzeug aus der Hand schlug.
Marcel war im Dunkeln vergraben.
Robert richtete sich auf und schaute
hoch zum Flur. Kaum noch war der
Schatten des Fensterkreuzes zu sehen.
Bald würde es draußen dunkel sein.
War da nicht Musik? Nein, sicher der
Wind. Er wollte einen Schritt höher
gehen, das Loch überschreiten. Aber
drohend knackte das Holz. Langsam
zog er sich zurück. Der weiße Salon
blieb unerreichbar.
(c) Klaus Dieter Schley